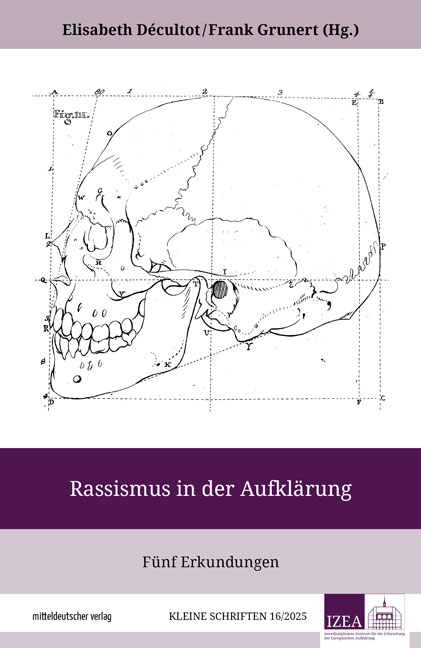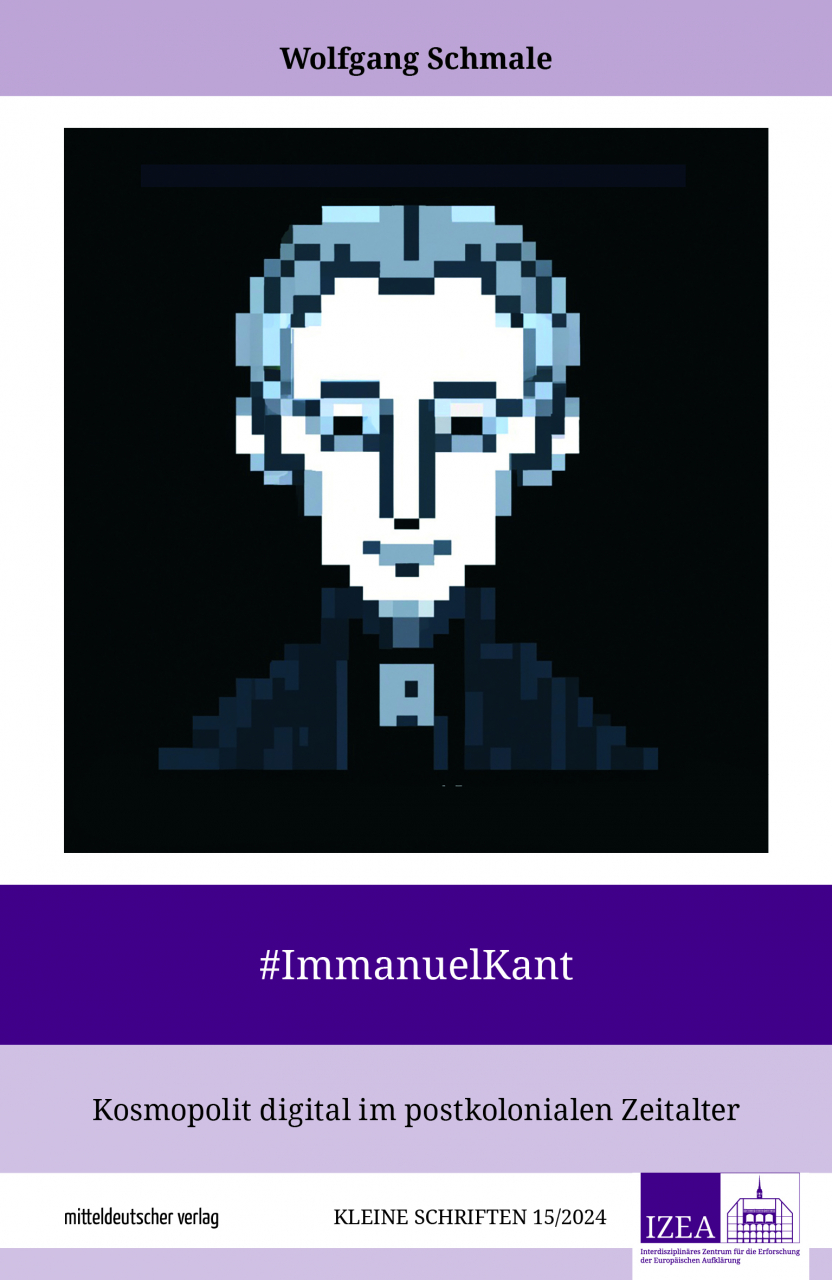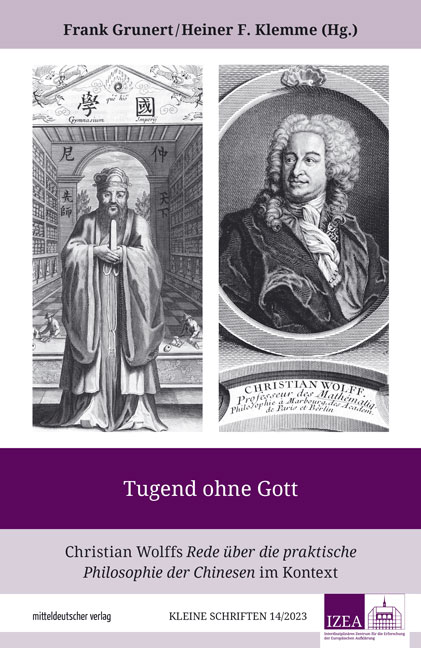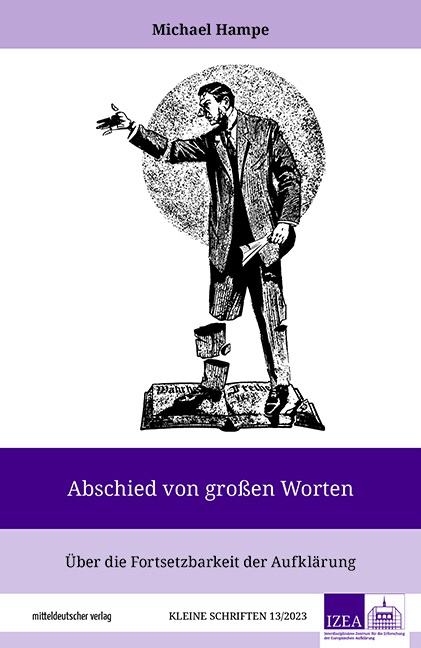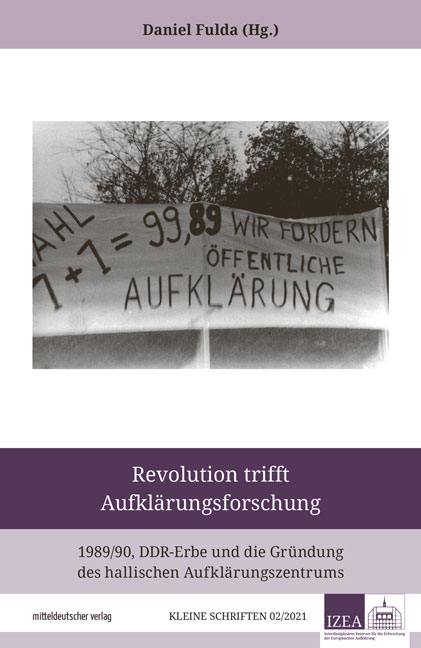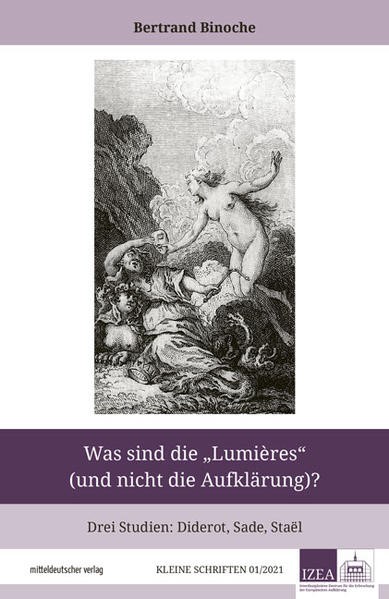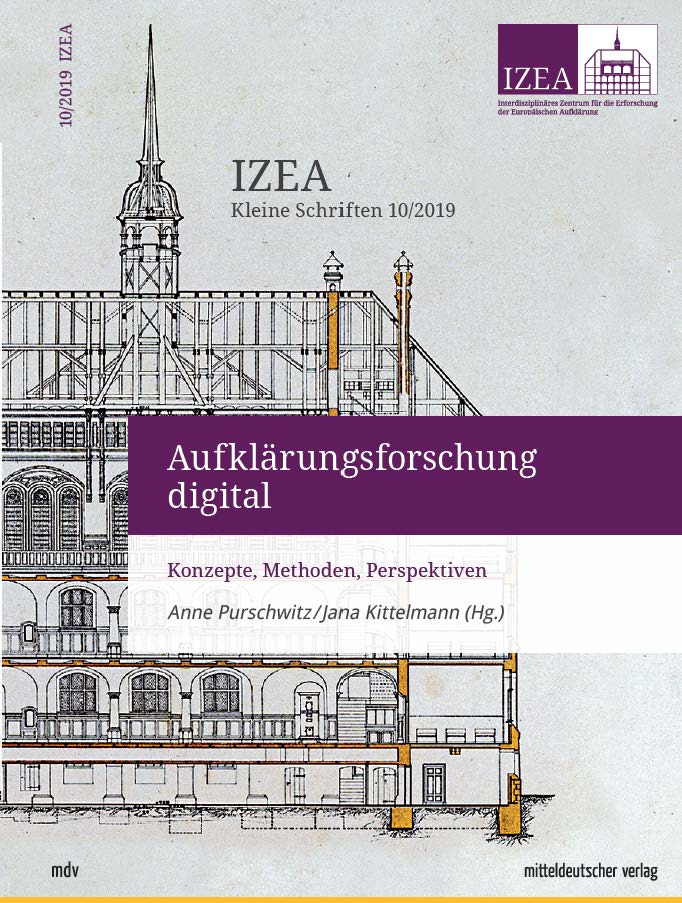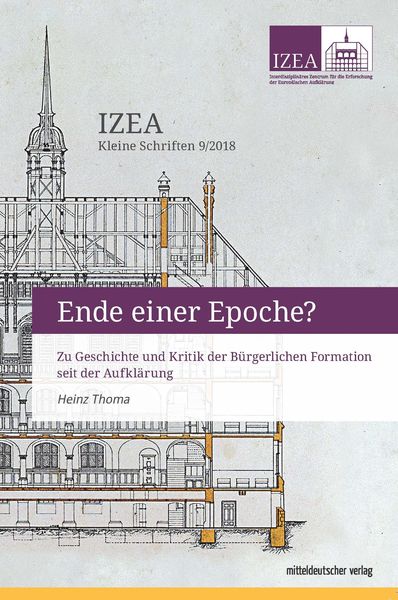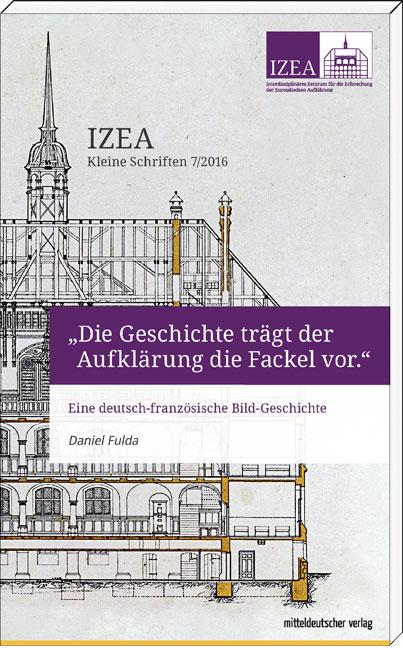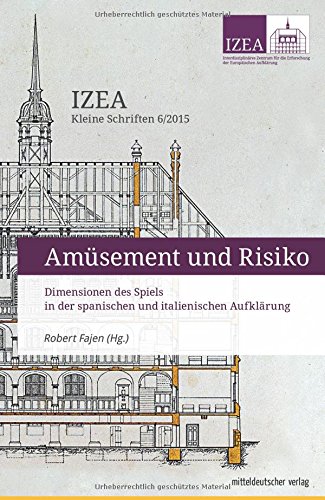Kleine Schriften
Rassismus in der Aufklärung, Bd. 16
Elisabeth Décultot und Frank Grunert (Hg.):
Rassismus in der Aufklärung. Vier Erkundungen.
Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2025
IZEA – Kleine Schriften 16/2025
ISBN 978-3-96311-954-5 
Lange Zeit galten Rassismus und Aufklärung – auch in historischer Hinsicht – als diametral entgegengesetzte Begriffe. Mehr noch: Aufklärung schloss nicht nur Rassismus aus, sondern wurde und wird als das entscheidende Mittel angesehen, gegen Rassismus – d. h. die Abwertung und Unterordnung von Menschen aufgrund abweichender äußerer Merkmale, etwa Hautfarbe – vorzugehen. Neuere Forschungen zeigen indes, dass bedeutenden Aufklärern rassistische Denkmuster durchaus geläufig waren. Der dem Thema „Rassismus in der Aufklärung“ gewidmete Band der „Kleinen Schriften des IZEA“ legt Erkundungen aus unterschiedlichen Disziplinen vor und versteht sich als eine weitere Anregung zu einer notwendigen Diskussion.
#immanuelkant - Bd. 15
Wolfgang Schmale
#ImmanuelKant. Kosmopolit digital im postkolonialen Zeitalter.
Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2024
IZEA - Kleine Schriften Bd. 15
ISBN 978-3-96311-893-7
Ein "digitaler" Blick auf den Philosophen zum 300. Geburtstag 2024
Immanuel Kant gehört zu den bekanntesten Philosophen der Aufklärung. Das Buch zeichnet erstmals ein Porträt des „digitalen Kant“ in Europa, Asien, Afrika und Amerika. Denn wer im Digitalzeitalter etwas über historische Persönlichkeiten erfahren möchte, startet eine Websuche, liest den Wikipedia-Artikel, sucht ein YouTube-Video …. Längst besitzen historische Persönlichkeiten eine digitale Identität und die meisten, die sich z.B. für Immanuel Kant interessieren, kommen zuerst mit dieser digitalen Identität in Kontakt. Der digitale Kant etwa trägt dazu bei, dass die Aufklärung global so populär wie nie zuvor ist. Mit seiner Untersuchung hat Wolfgang Schmale Neuland betreten und erstaunliche Ergebnisse zutage gefördert.
Zum Autor:
Prof. Dr. Wolfgang Schmale, geb. 1956 in Würzburg, ist ein international bekannter Neuzeithistoriker in Wien. Er ist Mitglied der europäischen Akademien „Academia Europaea“ und „European Academy of Sciences and Arts“ sowie des Wissenschaftlichen Beirats des „Hauses der Europäischen Geschichte“ (Brüssel). Die Aufklärung, u.a. ihre Rezeption, aber auch ihre Popularität in unserer Zeit, gehört zu seinen Publikationsschwerpunkten.
Link zum Inhaltsverzeichnis auf der Verlagshomepage
Link zum Verlag
Tugend ohne Gott, Bd. 14
Frank Grunert und Heiner F. Klemme (Hg.): Tugend ohne Gott. Christian Wolffs Rede über die praktische Philosophie der Chinesen im Kontext. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2023 (IZEA - Kleine Schriften, Bd. 14)
Wolffs im Sommer 1721 gehaltene Rede über die praktische Philosophie der Chinesen wurde ihm von seinen Gegnern übelgenommen. Am Ende trug sie nicht unwesentlich zu seiner Vertreibung aus Halle bei. Was hat es mit dem Text auf sich? Was vermittelt er? Welche Ziele verfolgte Wolff mit einer Rede, die sich mit der chinesischen Philosophie befasst, die doch räumlich und inhaltlich sehr weit von den theoretischen Auseinandersetzungen in Europa entfernt war? Der Sammelband nimmt den eigentlichen Inhalt der Rede, ihre Voraussetzungen und ihre weiterreichenden Wirkungen in den Blick.
Link zum Verlag
Abschied von großen Worten. Über die Fortsetzbarkeit der Aufklärung, Bd. 13
Michael Hampe: Abschied von großen Worten. Über die Fortsetzbarkeit der Aufklärung. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2023 (IZEA - Kleine Schriften, Bd. 13)
Die Aufklärung hat gegenwärtig keinen guten Ruf. Die einen betrachten sie als Teil eines kolonialistischen Prozesses, der von Europa aus Leid über alle anderen Menschen auf der Erde gebracht hat. Die anderen sehen die Großtheorien des Subjekts und der Freiheit, die Aufklärungsbewegungen zugrunde lagen, als überholt an.
Beide Diagnosen sind richtig. Trotzdem ist die Aufklärung nicht vorbei. Sie behält als ein skeptisches emanzipatorisches Projekt der Vermeidung von Illusionen und Grausamkeiten weiterhin ihre Berechtigung und ist für die Entwicklung einer globalen Kultur, in der Menschen in der Lage sind, gemeinsam zu entscheiden, wie sie überleben und gut leben wollen, nötiger denn je.
Das Buch enthält drei Aufsätze von Michael Hampe, die sich dieser Thematik annehmen.
Der Band basiert auf einem Vortrag, den Prof. Hampe im Rahmen der Halle Lectures 2021/22 im Dezember 2021 gehalten hat.
Bei den Halle Lectures handelt es sich um eine Kooperation des IZEA mit dem Interdisziplinären Zentrum für Pietismusforschung (IZP), den Franckeschen Stiftungen und dem Landesforschungsschwerpunkt "Aufklärung Religion Wissen" (ARW)
Link zum Verlag
Revolution trifft Aufklärungsforschung, Bd. 12
Daniel Fulda (Hg.): Revolution trifft Aufklärungsforschung. 1989/90 DDR-Erbe und die Gründung des hallischen Aufklärungszentrums. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2021 (IZEA - Kleine Schriften, Bd. 12)
Die Aufklärungsbewegung des 18. Jahrhunderts wurde im Osten auch als erster Schritt zum Sozialismus interpretiert. Als sich 1989 eine Revolution im Sozialismus ereignete, war die DDR-Aufklärungsforschung aber keineswegs vorne mit dabei. Trotzdem darf man die Gründung eines Forschungszentrums zur Aufklärung, die an der Universität Halle bereits vor 1989 betrieben wurde, ein Avantgarde-Unternehmen nennen. Denn damit setzte auch eine enge Kooperation mit bundesdeutschen Forschungseinrichtungen ein. Die Geschichte des hallischen Aufklärungszentrums ist somit von Anfang an eine gesamtdeutsche.
Link zum Verlag
Was sind die Lumieres (und nicht die Aufklärung)? Bd. 11
Bertrand Binoche (Hg.): Was sind die Lumieres (und nicht die Aufklärung)? Drei Studien: Diderot, Sade, Staël. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2022 (IZEA - Kleine Schriften, Bd. 11)
Als Michel Foucault in den 1980ern fragt: »Qu’est-ce que les Lumières?«, kommentiert er Kants Beantwortung einer eigentlich anderen Frage: »Was ist Aufklärung?«. Es mag verwegen erscheinen, sich erneut an eine Definition zu wagen. Doch erst, wenn man bestimmt hat, was die ‚Lumières‘ sind, lässt sich danach fragen, ob man damit auch die ‚Aufklärung‘ definiert hat oder ob zwischen beiden Begriffen Differenzen zu Tage treten.
Bertrand Binoche ist seit 2004 Professor am Institut für Philosophie der Universität Paris I Panthéon-Sorbonne und Autor zahlreicher viel beachteter Studien zur Philosophie der europäischen Aufklärung.
Link zum Verlag
Aufklärungsforschung digital, Bd. 10
Jana Kittelmann und Anne Purschwitz (Hg.): Aufklärungsforschung digital. Konzepte, Methoden, Perspektiven. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2019 (IZEA - Kleine Schriften, Bd. 10)
Durch eine Vielzahl umfangreicher Digitalisierungsprojekte hat sich die Verfügbarkeit unterschiedlichster Quellengattungen deutlich erhöht. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf die Theorie und Praxis der Geisteswissenschaften. In diesem Kontext wird auch die Aufklärungsforschung mit neuen Fragestellungen, (digitalen) Möglichkeiten und Methoden konfrontiert. Der Einfluss digitaler Techniken, Methoden und Werkzeuge ist dabei in vielfältiger Hinsicht spürbar. Zugänge zu großen Mengen an Wissen und quantitativ entgrenzten Informationen implizieren nicht nur neue Formen der Recherche, Such und Sortiermöglichkeiten, sondern wirken sich unmittelbar auf die Aufbereitung, Analyse und (Re)Präsentation von historischem und wissenschaftlichem Material aus.Gebiete wie die Editionswissenschaft, die Brief und Zeitschriftenforschung oder die methodischen Ansätze von Anthologien und historischer Netzwerkanalyse können nachhaltig von diesen Einflüssen durch die Digital Humanities, die sich noch in der Formierungsphase befinden, profitieren. Zeitgleich stellen die digitalen Analyse- und Darstellungsmethoden auch neue Aufgaben und fachspezifische Herausforderungen an ForscherInnen und bedürfen in diesem Zusammenhang ebenfalls einer kritischen Reflexion.Dieser Band geht anhand einzelner Fallstudien den Chancen, Aufgaben und auch Problemen digitaler Arbeits- und Forschungsumgebungen nach. Die medienübergreifende Arbeit mit historischen Materialien (Briefe, Zeitschriften, historische Textkorpora) rücken dabei ebenso ins Blickfeld wie neue Möglichkeiten der digitalen Präsentation und Analyse von Ergebnissen.
Link zum Verlag
Ende einer Epoche? Bd. 9
Heinz Thoma (Hg.): Ende einer Epoche? Zu Geschichte und Kritik der Bürgerlichen Formation seit der Aufklärung. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2019 (IZEA - Kleine Schriften, Bd. 9)
Im vorliegenden Band untersucht Heinz Thoma, ob unsere Gesellschaft westlichen Typs im Begriff steht, den Kern ihrer gesellschaftlichen Voraussetzungen zu verlassen, und inwiefern die Ursache für diese Verlustgeschichte bereits im Zeitalter der Aufklärung gründet. Diese Prüfung erfolgt in fünf Kapiteln mit den Themen: Aufstieg und Fall des modernen Subjekts; Das gescheiterte Glücksversprechen der Aufklärung; Unterscheidbarkeit von Freiheit und Zwang durch Vergesellschaftung; Geschichte der Vernunftkritik (Traditionalismus, Kritische Theorie, Foucault, Lyotard); Religion - Vernunft - Natur in der Aufklärung.
Link zum Verlag
Exzerpt, Plagiat, Archiv, Bd. 8
Elisabeth Décultot und Helmut Zedelmaier (Hg.): Exzerpt, Plagiat, Archiv. Untersuchungen zur neuzeitlichen Schriftkultur.Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2017 (IZEA - Kleine Schriften, Bd. 8)
Wer liest, holt aus dem Gelesenen gelegentlich etwas heraus, um es weiterzuverarbeiten. "Exzerpieren" bezeichnet diese Tätigkeit, "Exzerpt" deren Produkt. Welche Geschichte hat das Exzerpieren? Welche Rolle spielt in dieser Geschichte das Plagiat, welche das Archiv? Die drei Beiträge dieses Bandes untersuchen den Wandel, dem Textproduktionen und musikalische Kompositionen zwischen Früher Neuzeit und Moderne unterworfen waren, aus soziologischer, musikwissenschaftlicher und archivhistorischer Sicht. Eine Einführung stellt die Untersuchungen in den Zusammenhang neuerer Forschungen zur Praxeologie und Materialität von Literatur, Wissen und Wissenschaft.
Link zum Verlag
"Die Geschichte trägt der Aufklärung die Fackel vor", Bd. 7
Daniel Fulda (Hg.): "Die Geschichte trägt der Aufklärung die Fackel vor". Eine deutsch-französische Bild-Geschichte. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2016 (IZEA - Kleine Schriften, Bd. 7)
In der Frühaufklärung wird die Historie - das Wissen vom Gewesenen und Gewordensein - zur unentbehrlichen Voraussetzung von Erkenntnisfortschritten und zielstrebigem Handeln aufgewertet. Die Historie soll den Weg erhellen, auf dem man in eine bessere Zukunft gelangt, und wird deshalb als Fackel angesprochen oder bildlich mit einer Fackel dargestellt. Woher die geschichtsbezogene Fackelsymbolik kommt und wie sie sich im Laufe des 18. und frühen 19. Jahrhunderts weiterentwickelte, verfolgt das Buch anhand eines breiten Spektrums von Texten und Bildern von historiographischen und literarischen Klassikern bis zu revolutionären Zeitungen.
Link zum Verlag
Amüsement und Risiko, Bd. 6
Robert Fajen (Hg.): Amüsement und Risiko. Dimensionen des Spiels in der spanischen und italienischen Aufklärung. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2015 (IZEA - Kleine Schriften, Bd. 6)
Welche Chancen bietet der Spiel-Begriff für die Aufklärungsforschung? Auf diese Frage gibt der vorliegende Band vielfältige Antworten: programmatisch in einem Einführungsaufsatz und exemplarisch in drei Fallstudien zur spanischen und italienischen Kunst und Literatur des 18. Jahrhunderts. Der thematische Bogen reicht dabei von den gesellschaftstheoretischen Überlegungen Gaspar Melchor de Jovellanos’ (1744–1811) über die Romane Pietro Chiaris (1712–1785) bis hin zu den subversiven Bilderwelten, die Giandomenico Tiepolo (1727–1804) in seinem rätselhaften Mappenwerk Divertimento per li Regazzi festgehalten hat.
Concepts of (radical) Enlightenment, Bd. 5
Frank Grunert (Hg.): Concepts of (radical) Enlightenment. Jonathan Israel in Discussion. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2014 (IZEA - Kleine Schriften, Bd. 5)
Der Band geht auf das gleichnamige Symposion zurück, das im Rahmen der Gastprofessur Jonathan I. Israels am IZEA am 5. Juli 2012 stattfand. Der in Princeton forschende britische Historiker begreift Aufklärung als ein pan-europäisches Phänomen, das die grundlegendste und folgenreichste intellektuelle, soziale und kulturelle Transformation der westlichen Welt seit dem Mittelalter darstellt. In seiner ungemein materialreichen, dreibändigen Geschichte der Aufklärung – Radical enlightenment (2001), Enlightenment Contested (2006) und Democratic Enlightenment (2011) – entwickelt Israel einen von dem niederländischen Philosophen Benedict de Spinoza ausgehenden Begriff von radikaler Aufklärung, der auf genau acht, heute noch aktuellen Kernprinzipien beruht: reason as exclusive criterion of truth, rejection of supernatural agency, equality of all mankind, secular ‚universalism‘ in ethics, toleration, personal liberty of lifestyle and sexual conduct, freedom of expression, und schließlich democratic republicanism. Den Verfechtern dieser radikalen und auf Veränderung zielenden Aufklärung – Denker wie Spinoza, Bayle und Diderot – standen moderate Aufklärer gegenüber, die – wie Locke, Hume oder Voltaire – in ihren Forderungen weniger weit gingen und eher bereit waren, die gegebenen Verhältnisse zu respektieren. Israels scharfer Begriff von Aufklärung, ihre Zweiteilung und ihre entschiedene normative Aufladung hat international zu Diskussionen geführt, die in Deutschland bisher noch nicht angekommen sind. Der vorliegende Band will dazu einen ersten Einstieg bieten. Es diskutieren Ursula Goldenbaum, Martin Mulsow, Robert Schnepf und Winfried Schröder im Anschluss an ein Statement von Israel Chancen und Grenzen von dessen umstrittenem Aufklärungsbegriff.
Link zum Verlag
Briefwechsel, Bd. 4
Erdmut Jost und Daniel Fulda (Hg.): Briefwechsel. Zur Netzwerkbildung in der Aufklärung. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2012 (IZEA - Kleine Schriften, Bd. 4)
Das 18. Jahrhundert gilt als Epoche der ‚Geselligkeit‘. In einem vorher ungekannten Ausmaß schließen sich Gelehrte und Gebildete, Künstler und Laien, Bürger und Adlige in Sozietäten, Zirkeln und Freundschaftsbünden zusammen: Hier beginnt nicht weniger als die moderne Netzwerkgesellschaft. Medium wie Agens dieser Vergesellschaftung sind Briefe – oder genauer: Briefwechsel. An ihnen lässt sich beobachten, wie Netzwerke entstehen, wie sie ausgebaut werden, welche Ziele die Teilnehmer haben und welche Taktiken sie verwenden. Ausgehend von den großen Briefeditionen, die am IZEA in Arbeit sind, diskutiert unser Band die besonderen Charakteristika aufklärerischer Briefwechsel und die Chancen, die sie der Forschung bieten.
Link zum Verlag
Händels „Messiah“, Bd. 3
Wolfgang Hirschmann (Hg.): Händels „Messiah“. Zum Verhältnis von Aufklärung, Religion und Wissen im 18. Jahrhundert. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2011 (IZEA - Kleine Schriften, Bd. 3)
Händels 'Messiah' ist ein Werk der Grenzüberschreitungen: Seine epische Anlage als Bibel-Kompilation und der Anspruch, das Leben Jesu sowie die gesamte christliche Heilsgeschichte in eine geschlossene Folge zu bringen, sprengten alle damaligen Vorstellungen von religiöser Musik und führten zu erhitzten poetologischen und religiösen Debatten. Die ästhetischen Vorgaben, die Händel die kompositorischen Mittel an die Hand gaben, um den gewaltigen Stoff zu gestalten, liegen in der modernen Theorie des Erhabenen. Der Band möchte die Bedeutung des Händel'schen 'Messiah' aus den Fragen erklären, die durch das Ineinandergreifen von Aufklärung, Religion und Wissen im 18. und frühen 19. Jahrhundert neu aufgeworfen wurden, jene nämlich nach neuen wirkungsästhetischen Konzeptionen, nach einer aufgeklärten Neuverortung religiöser Musik und der Konstituierung neuer Normen.
Kulturmuster der Aufklärung, Bd. 2
Daniel Fulda (Hg.): Kulturmuster der Aufklärung. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2010 (IZEA - Kleine Schriften, Bd. 2)
Als 'Kulturmuster' lassen sich solche Kopplungen von Konzepten und Praktiken bezeichnen, die die relative Beständigkeit kultureller Routinen gewonnen haben. Kulturmuster strukturieren die Wahrnehmung und Interpretation von Welt und steuern zugleich Kommunikation und Handeln. In Europa bildet, so die Hypothese, die Aufklärung die große und bis heute wirkungsmächtigste Epoche der Kulturmusterprägung. Der Band stellt die Kulturmuster-Heuristik vor, begründet sie im Kontext geistes- und sozialwissenschaftlicher Methodendiskussionen und erprobt sie in exemplarischen Skizzen.
Galanterie und Frühaufklärung, Bd. 1
Daniel Fulda (Hg.): Galanterie und Frühaufklärung. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2009 (IZEA - Kleine Schriften, Bd.1)
Mit dem Beginn der Aufklärung ändern sich auch die Verhaltensmuster. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Galanterie – das Streben nach dem Gefallen der anderen. In den Pariser Salons wird das ursprünglich höfische Konzept anders fortentwickelt als von deutschen Gelehrten. Welcher Epoche die Galanterie angehört und an welche Trägerschicht sie mit welchen Intentionen adressiert ist, diskutieren die Beiträge dieses Heftes unter der gemeinsamen Hypothese, dass in der Galanterie die epochalen Verschiebungen und Übergänge der Zeit um 1700 zum Ausdruck kommen.