Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung
Prädestiniert durch ihre Geschichte als erstes Zentrum der deutschen Aufklärung mit transnationaler Wirkung, gründete die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1993 das Interdisziplinäre Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung (IZEA).
Zu den gegenwärtigen Forschungsschwerpunkten gehören die Frühaufklärung, das Naturrecht, Kant, der Klassizismus, der internationale Wissenstransfer und die Gelehrtenkulturen sowie die neuen Schreibweisen, Ästhetiken und Geschichtsdiskurse der Aufklärung. Die Ergebnisse dieser Forschungen werden seit 1995 in der Reihe "Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung" im Verlag De Gruyter (Berlin/Boston) veröffentlicht. Hinzu kommen qualifizierte Arbeiten, die extern entstanden sind. Pro Jahr erscheinen zwei bis vier Bände (Monographien, Sammelbände, Quellenkommentare).
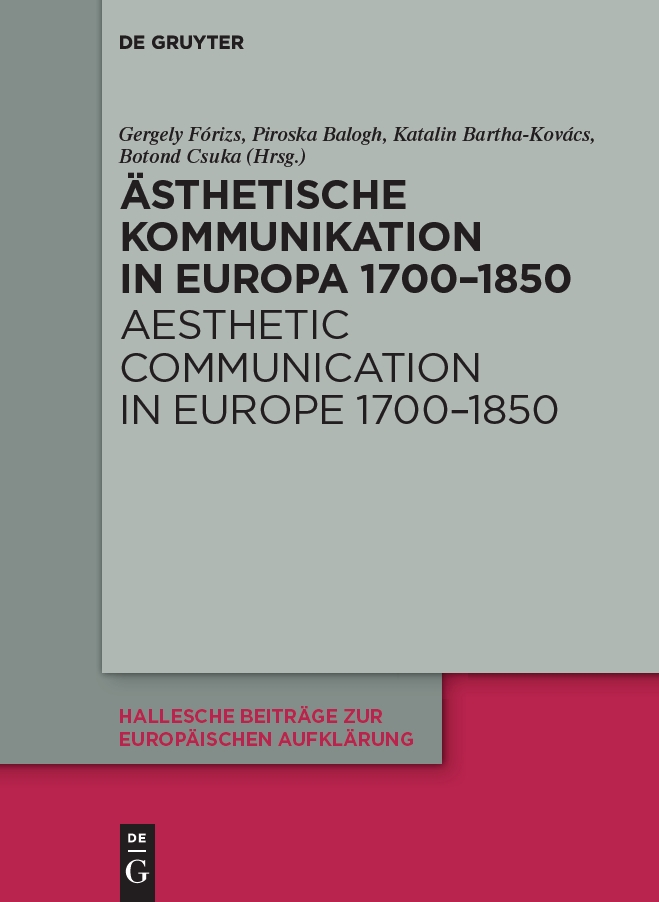
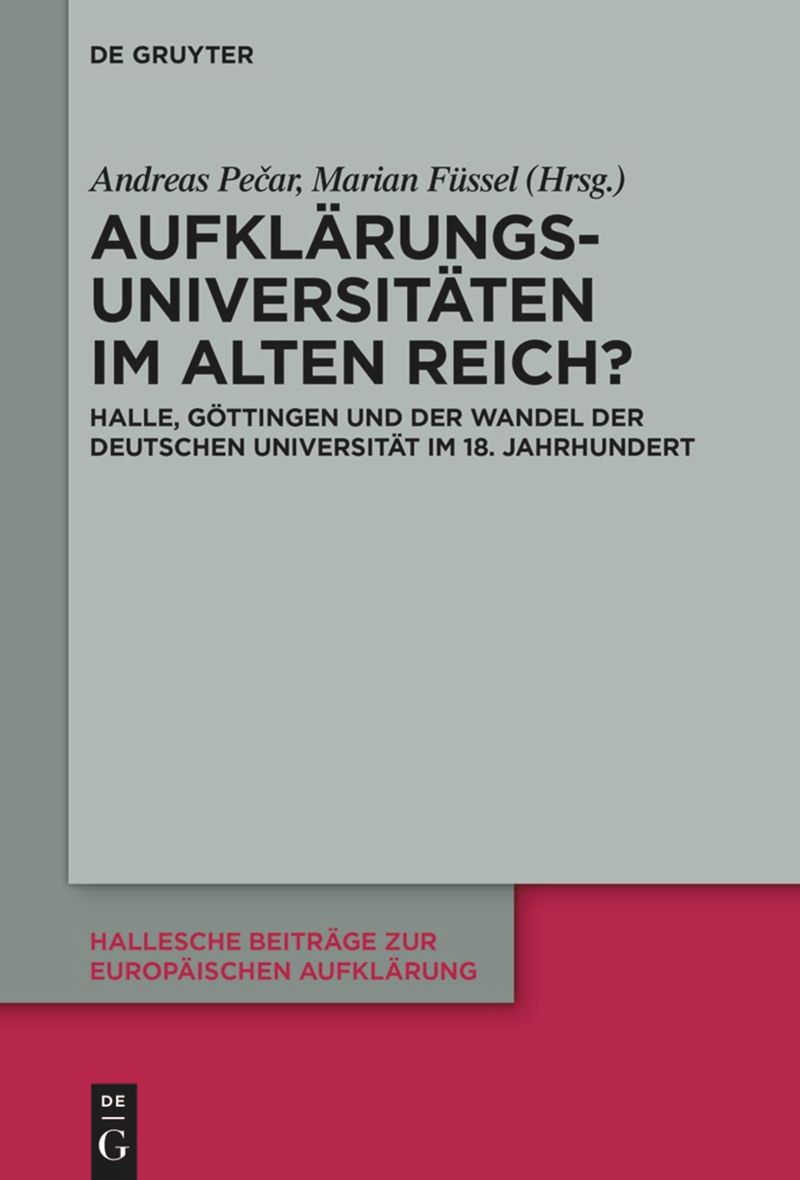
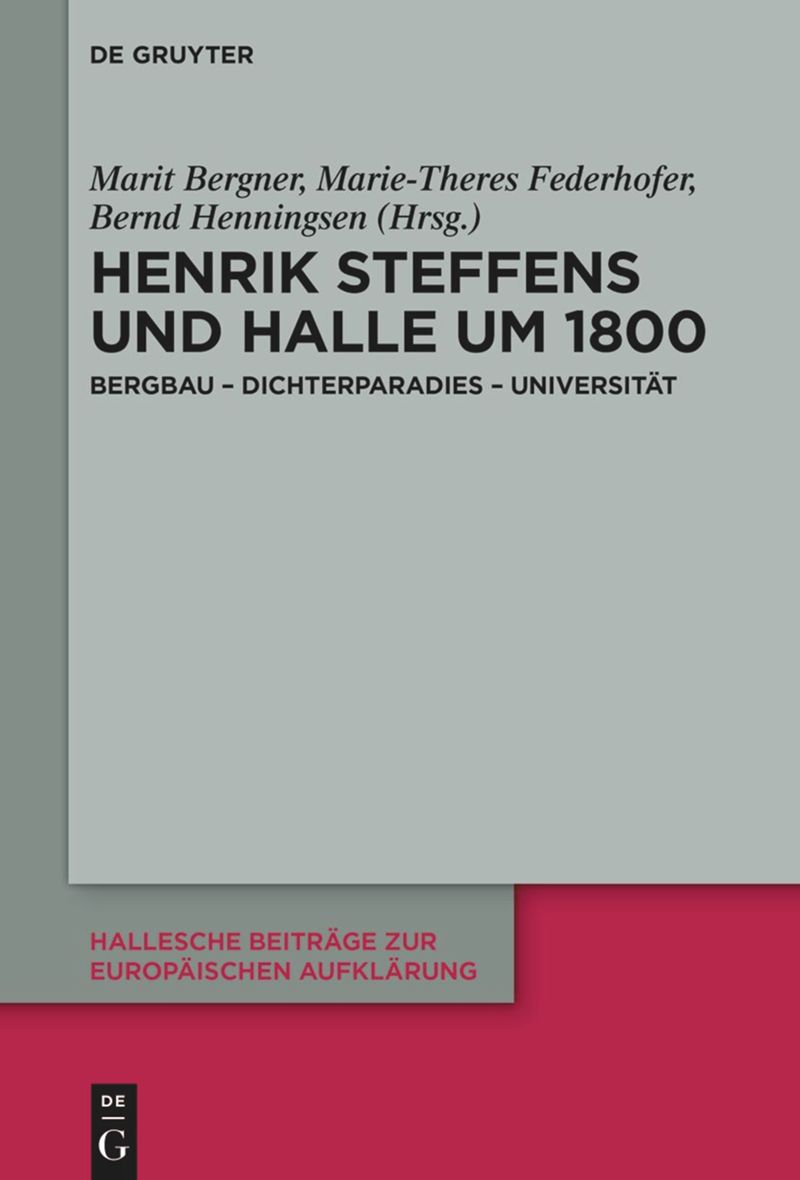
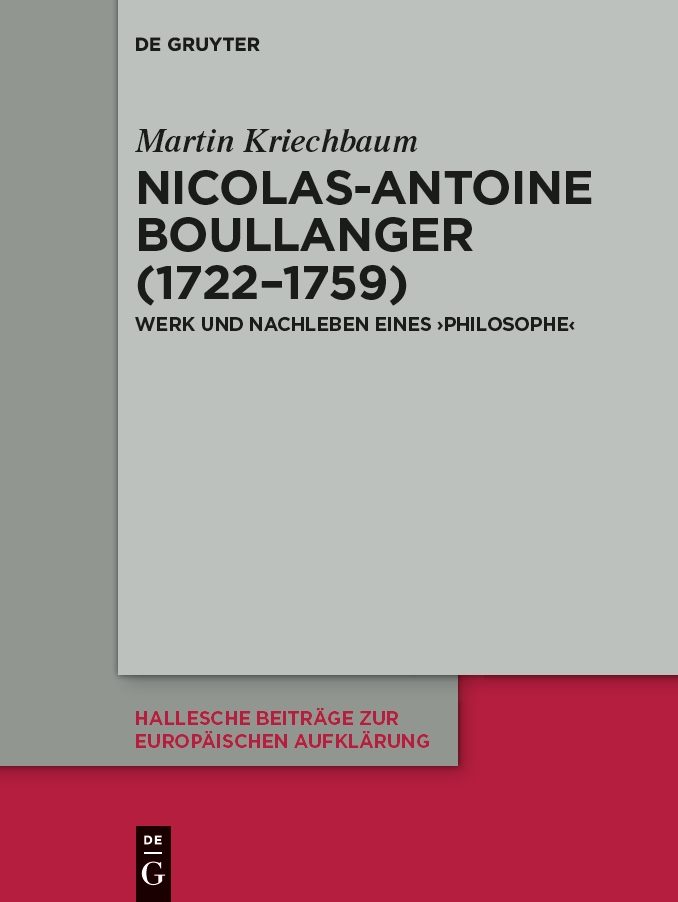
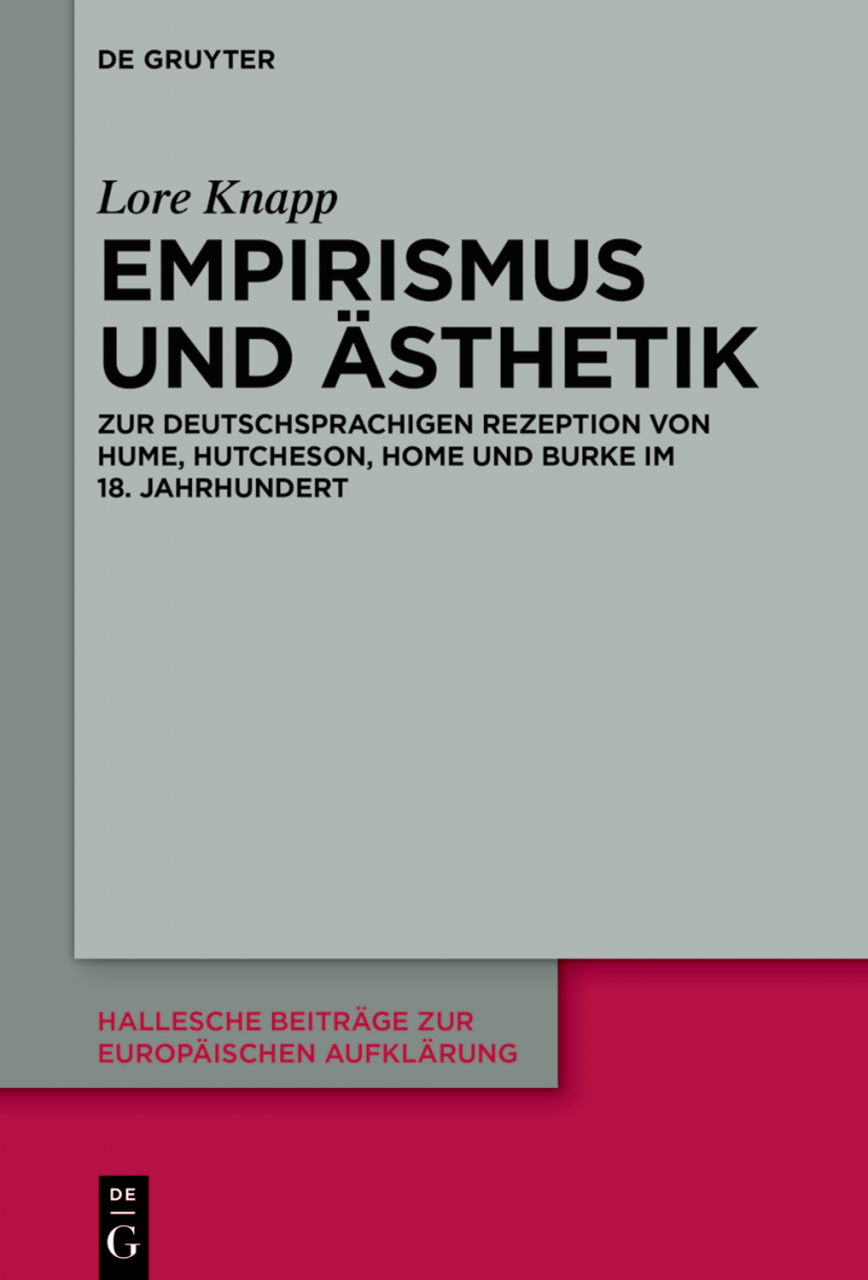
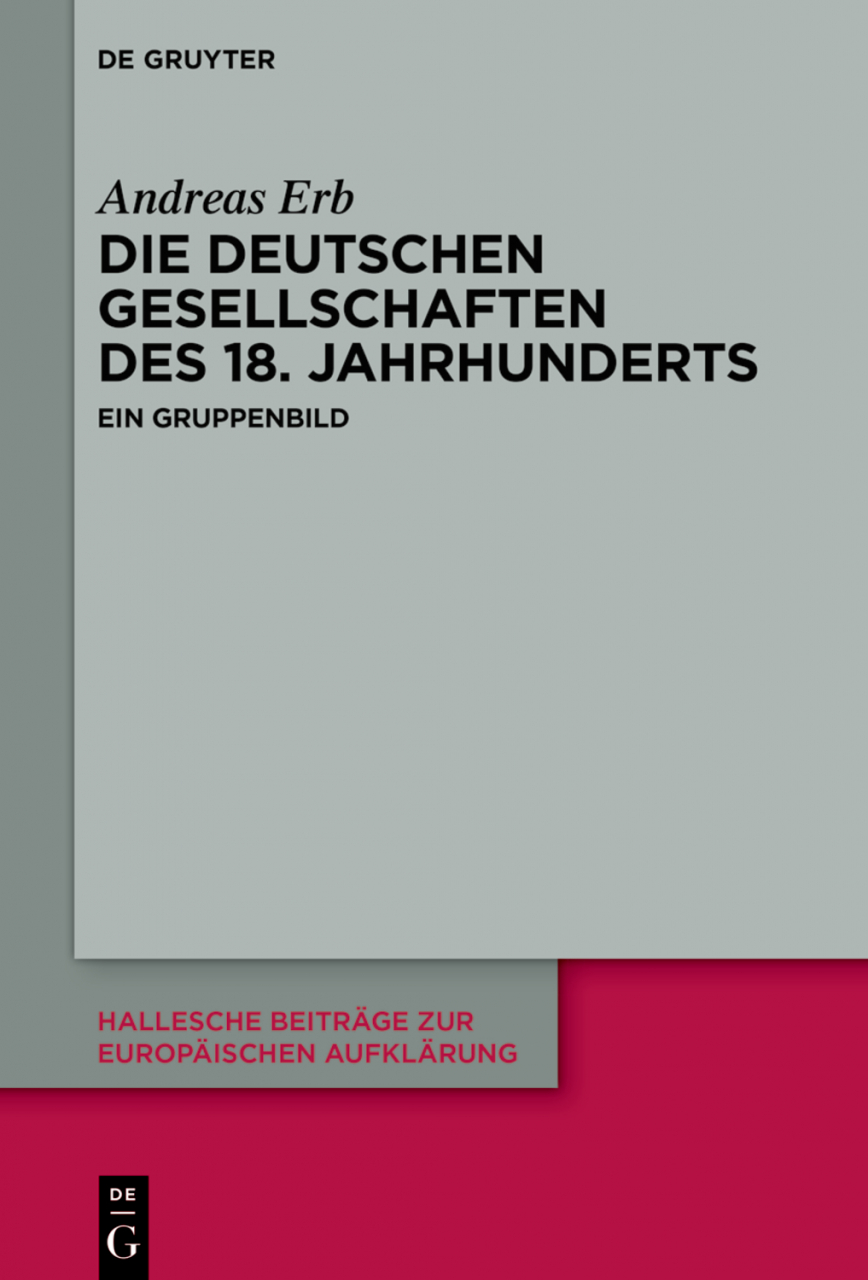

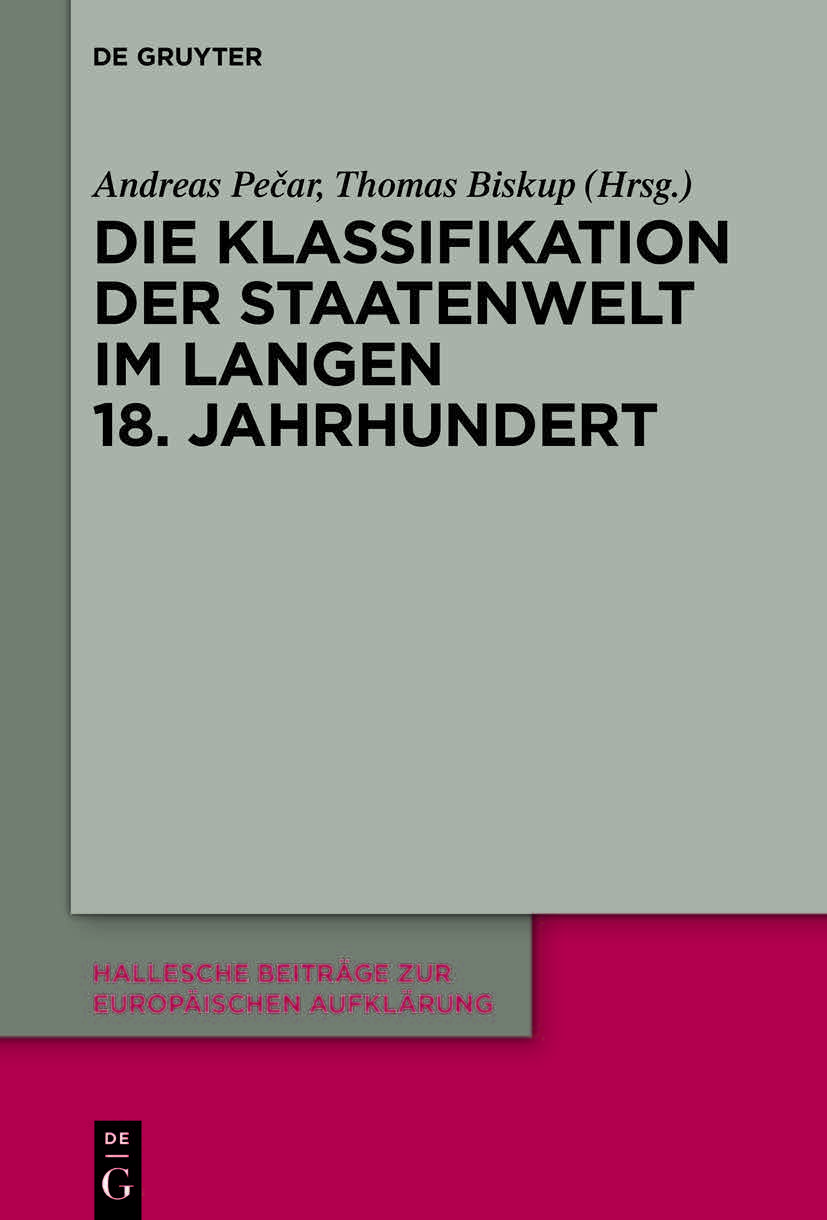
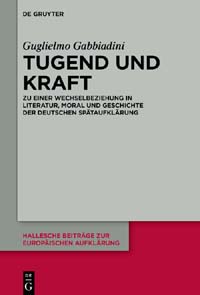
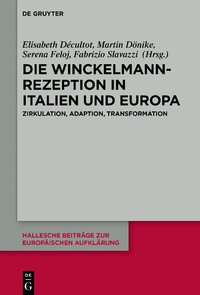
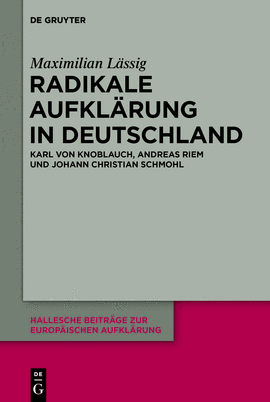

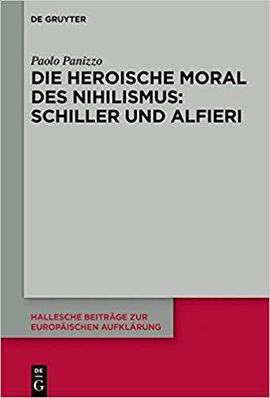
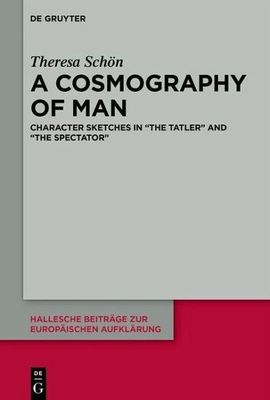
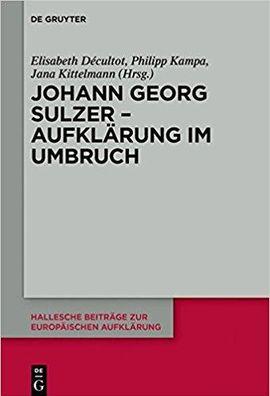

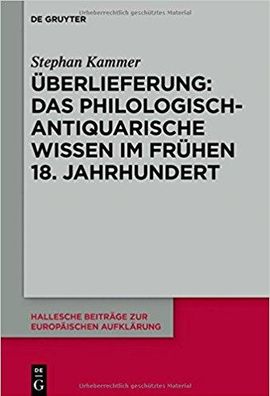
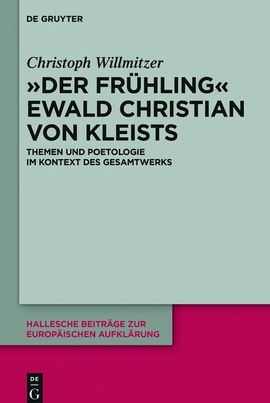
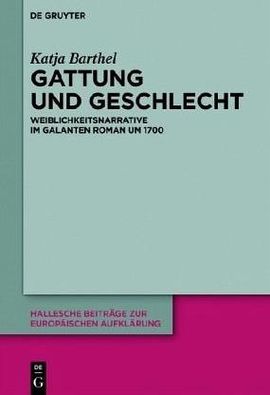
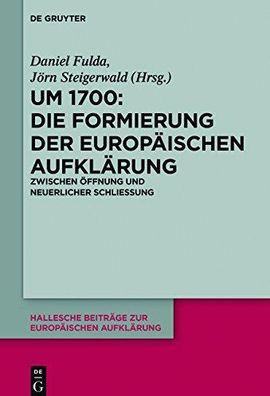
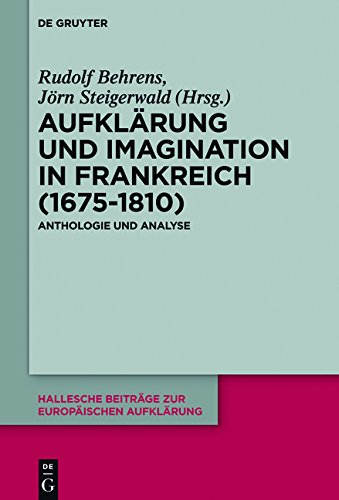
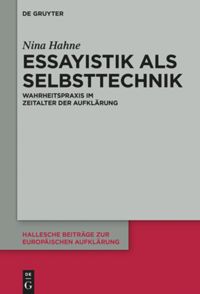

Bisher erschienen
Bd. 51
Annette Graczyk: Die Hieroglyphe im 18. Jahrhundert. Theorien zwischen Aufklärung und Esoterik. Berlin/Boston: de Gruyter 2015 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 51).
Die Hieroglyphen waren im 18. Jahrhundert eine Herausforderung für die Aufklärung und zugleich ein willkommener Gegenstand für die Esoterik. Sie galten – über den Ägyptenbezug hinaus – als rätselhafte Reste einer vorzeitigen, unbekannt gewordenen Kommunikation zwischen Bilderschrift, Gestensprache und Symbolik und erlangten eine Schlüsselstellung in der Sprach- und Schrifttheorie, der Kulturanthropologie, der Theologie und der Theosophie, aber auch in Physiognomik und Kunsttheorie. Man sah in ihnen die dunklen Anfänge jeglicher Kultur, in denen die Menschen gleichsam noch mit den Göttern verkehrten. Teils wurden sie dabei kulturanthropologisch interpretiert: die Hieroglyphen waren die heiligen Zeichen einer theokratischen Kultur, die sich durch Religion und Göttervorstellungen ihr Weltbild schuf. Teils wurden sie mit Hilfe hermetischer und neuplatonistischer Traditionen zu Botschaften des Göttlichen sakralisiert. Insgesamt erweist sich die Hieroglyphe im 18. Jahrhundert für Aufklärer und Esoteriker als Begriff, mit dem scheinbar disjunktive Phänomene wie Bild, Gestik und Schrift, Mythos und Logos sowie Metapher, Gleichnis, Metonymie und Allegorie als miteinander zusammenhängend oder zumindest kombinierbar angesprochen werden.
Link zum Verlag
Bd. 50
Monika Neugebauer-Wölk, Renko Geffarth, Markus Meumann (Hrsg.): Aufklärung und Esoterik: Wege in die Moderne. Berlin/Boston: de Gruyter 2013 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 50).
Der Einfluss der Aufklärung auf die säkularisierenden Tendenzen des 19. und 20. Jahrhunderts ist integraler Bestandteil heutiger Selbstvergewisserung. Welche Bedeutung aber hat das 18. Jahrhundert für die Entstehung moderner Esoterik? Kann das vielschichtige Verhältnis von Aufklärung und Esoterik im 18. Jahrhundert vielleicht ebenfalls als konstitutiv für die Moderne begriffen werden? Die Beiträge dieses Bandes untersuchen, durch welche Transformationsprozesse die frühneuzeitlichen Strömungen der Hermetik, Magie, Alchemie oder Kabbala über die Aufklärung hinweg in die Wissensbestände von Spiritismus, Okkultismus und Theosophie gelangten. Sie identifizieren Probleme und Themen, die den Übergang zur modernen Esoterik möglich machten, und fragen nach den theoretisch-systematischen Grundlagen dieser Entwicklung. Dabei wird deutlich, wie sehr sich die esoterischen Bewegungen nach 1800 selbst als treibende Kräfte von Verwissenschaftlichung und Säkularisierung verstanden. Mehr als 30 Autorinnen und Autoren unterschiedlicher Disziplinen verfolgen diese „Wege in die Moderne“ auf den Feldern von Philosophie und Erkenntniskritik, von Literatur und bildender Kunst, von Wissenschaft und Gesellschaft.
Link zum Verlag
Bd. 49
Katja Battenfeld: Göttliches Empfinden. Sanfte Melancholie in der englischen und deutschen Literatur der Aufklärung. Berlin/Boston: de Gruyter 2013 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 49).
Kulturell kodierte Gefühle haben in vielfacher Weise strukturierende Eigenschaften für Individuen und ihre Gesellschaft. Die Bedeutung dieser Emotionskodes ist zwar bislang noch wenig erforscht, bildet aber ein vielversprechendes Feld der modernen Kulturwissenschaft. Die Studie widmet sich der Kultivierung der sanften Melancholie im 18. Jahrhundert aus der Perspektive der literaturwissenschaftlich gelagerten Emotionsforschung. Dabei gilt es, dem dominierenden Forschungsdiktum einer vermeintlich repressiven, negativen Melancholie im Zeitalter der Aufklärung positive Effekte und Ziele wie die Erziehung der Gefühle bis hin zu emotionaler Autonomie zur Seite zu stellen. Im Zentrum der Analyse stehen englische und deutsche Texte der Lyrik, Epik und Prosa zwischen 1720 und 1785.
Link zum Verlag
Bd. 48
Sonja Koroliov (Hrsg.): Emotion und Kognition. Transformationen in der europäischen Literatur des 18. Jahrhunderts. Berlin/Boston: de Gruyter 2013 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 48).
Wie verhält sich Emotionalitat zu Wissen und Erkenntnis? Was können wir von den Emotionen wissen? Wie beeinflussen Emotionen ihrerseits die Art, wie wir Erkenntnis gewinnen, unseren Umgang mit Wissen, unsere Orientierung in der Welt? Die Beiträge des Bandes nähern sich dem 18. Jahrhundert als einer Zeit, in der auf diese Fragen besonders originelle und bis heute wegweisende Antworten gefunden wurden. Sie behandeln Themen wie die Rolle der Emotionalität im anthropologischen Wissen, den Einfluss der Emotionen auf die Wahrnehmung oder die Bedeutung der Narrativität für den Umgang mit Emotionalität bei sich und anderen – für Selbstbeherrschung und -therapie, aber auch Fremdkontrolle und Manipulation.
Link zum Verlag
Bd. 47
Insa Kringler: Die gerettete Welt. Zur Rezeption des Cambridger Platonismus in der europäischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Berlin/Boston: de Gruyter 2013 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 47).
Die Studie untersucht, wie die Rezeption des Cambridger Platonismus die europäische Aufklärung wesentlich mitprägte. Es ist Leclercs Übersetzung des Cudworthschen 'True Intellectual System', die eine europaweite Debatte um die Leistungsfähigkeit der plastischen Natur auslöste, an der sich besonders Pierre Bayle, Leibniz, Lady Masham und Shaftesbury beteiligten. I. Kringler zeigt, wie durch die Diskussion um den Topos der ‚Welt‘ das Verhältnis von Theologie, Philosophie und Naturwissenschaft zu Beginn des 18 Jahrhunderts neu bestimmt worden ist.
Link zum Verlag
Bd. 46
Hans-Joachim Kertscher, Ernst Stöckmann (Hrsg): Ein Antipode Kants? Johann August Eberhard im Spannungsfeld von spätaufklärerischer Philosophie und Theologie. Berlin/Boston: de Gruyter 2012 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 46).
War der ebenso renommierte wie umstrittene Hallesche Popularphilosoph Johann August Eberhard (1739–1809) ein zu spät gekommener Aufklärer in der frühen Bildungsphase der Moderne, oder, im Gegenteil, sogar ihr Wegbereiter? Ziel der Beiträge des vorliegenden Bandes ist es, mittels eingehender Analyse die disziplinübergreifenden wissenschaftlichen Entwürfe Eberhards auf den Gebieten der Philosophie, Theologie, Ästhetik, Sprach- und Kulturtheorie kritisch zu interpretieren und zu einer Neubewertung des Werks im Kontext der zeitgenössischen Wissenschaftskonzepte zu gelangen.
Link zum Verlag
Bd. 45
Manfred Beetz, Andre Rudolph (Hrsg.): Johann Georg Hamann – Religion in der Gesellschaft. Acta des IX. Internationalen Hamann-Kolloquiums 2006. Berlin/Boston: de Gruyter 2012 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 45).
Um zu wissen, was der Mensch sei, notiert J. G. Hamann 1759 in den 'Brocken', müsse man die Verhältnisse befragen, in denen er lebe. Die 27 Beiträge des vorliegenden Bandes zeigen Hamann im Schnittpunkt gesellschaftlicher Konstellationen und stellen neue Fragen der Sozial- und Religionsgeschichte, der Gesellschaftstheorie, Ökonomie, Philosophie, Politik- und Religionswissenschaft an den Königsberger Gelehrten. Dadurch ermöglichen sie eine präzisere Positionsbestimmung Hamanns innerhalb zentraler Diskurse der Aufklärung.
Link zum Verlag
Bd. 44
Marianne Schröter: Aufklärung durch Historisierung. Johann Salomo Semlers Hermeneutik des Christentums. Berlin/Boston: de Gruyter 2012 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 44).
Die Hermeneutik bildet seit der Aufklärung eine der kritischen Grundlagen der Geisteswissenschaften. Ihre Einbeziehung in den Bereich der Geschichtserkenntnis ist vor allem mit dem Namen Johann Salomo Semler verbunden. Dies führte nicht nur zu einer methodischen Neubestimmung sämtlicher Fächer der Theologie. Vielmehr wurde der Begriff des Christentums insgesamt einem Prozess der Historisierung unterworfen. Marianne Schröter zeigt, dass die 'hermeneutische Frage' das Leitmotiv in Semlers Denken darstellt.
Link zum Verlag
Bd. 43
Frauke Berndt: Poema/Gedicht. Die epistemische Konfiguration der Literatur um 1750. Berlin/Boston: de Gruyter 2011 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 43).
An den unbegrifflichen Stellen literarischer Texte werden Alexander Gottlieb Baumgarten und Friedrich Gottlieb Klopstock auf das ganz eigene, durch nichts anderes zu ersetzende Vermögen sinnlicher Zeichen und Bilder bei der menschlichen Selbst- und Welterschließung aufmerksam. Zwischen 1730 und 1770 entsteht dabei eine Position in der Wissensordnung, an der das Denken, Können, Handeln, Sollen und Wollen der Literatur epistemisch begründet wird. Indem sowohl Philosoph als auch Dichter die kognitive wie mediale Komplexität des so genannten Gedichts (poema) ausloten, rücken sie die Literatur von den unscharfen Rändern der Wissensordnung in deren zentrales Sichtfeld. Baumgarten hält das Gedicht für die Protoform der sinnlichen Erkenntnis, deren Systematik er medientheoretisch, metaphysisch und ethisch ausarbeitet. Für Klopstock wird das Gedicht zum exklusiven Medium immanenter Transzendenz. Dass Gott und Liebe – die beiden sinnstiftenden Systeme der Moderne – nur noch im Gedicht erfahren werden können, zeigen die exemplarischen Lektüren des religiösen Versepos 'Der Messias' und der anakreontischen Ode 'Das Rosenband'. Am Schluss der Studie steht ein Ausblick auf die Symboltheorien des 18. und 19. Jahrhunderts, die das Erbe der epistemischen Konfiguration 'Poema/Gedicht' antreten.
Link zum Verlag
Bd. 42
Stefan Borchers: Die Erzeugung des 'ganzen Menschen'. Zur Entstehung von Anthropologie und Ästhetik an der Universität Halle im 18. Jahrhundert. Berlin/Boston: de Gruyter 2011 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 42).
Die sogenannte anthropologische Wende der Aufklärung steht seit geraumer Zeit im Zentrum literaturwissenschaftlicher Forschungen zum 18. Jahrhundert. Hatte die Frage nach dem 'ganzen Menschen' zunächst als Spezifikum der Spätaufklärung gegolten, so ist neuerdings ihre Relevanz schon für das zweite Drittel des 18. Jahrhunderts gezeigt worden. An der Universität Halle, wo sie Mediziner und Philosophen gleichermaßen umtrieb, entstanden um 1740 zeitgleich die Wissenschaften der Anthropologie und der Ästhetik, deren gemeinsame Konstitutionsbedingungen im Mittelpunkt dieses Buches stehen. Heuristisch zugespitzt auf die Lehre von der biologischen Generation, unternimmt es eine wissenschaftsgeschichtliche Neubestimmung des terminus a quo der anthropologischen Wende der Aufklärung.
Link zum Verlag
Bd. 41
Hans-Edwin Friedrich, Wilhelm Haefs, Christian Soboth (Hrsg.): Literatur und Theologie im 18. Jahrhundert. Berlin/Boston: de Gruyter 2011 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 41).
Das Verhältnis von Theologie und Literatur im 18. Jahrhundert lässt sich als ein insgesamt instabiles, im Detail schwieriges und offenes beschreiben: Die Theologie bewegt sich in der Spanne von Lutherischer Orthodoxie und rationalistischer Theologie zwischen erbaulicher cultura animi und vernünftiger Wissenschaft, die Literatur in der Spanne von Barock und Klassizismus und Romantik zwischen der Funktion einer ancilla theologiae und einer selbstbestimmten, zugleich Markt orientierten Institution. Solchermaßen sind Theologie und Literatur in wechselnden Konstellationen aufeinander bezogen: z. B. lernt die Theologie von der Literatur die Gemeinde als ein Publikum zu fesseln, und die Literatur will als Predigt von der Theologie einen Sinnstiftungs- und Orientierungsanspruch übernehmen. Diese und andere Konstellationen und Verhältnisse der Konkurrenz und der Ergänzung, der Konfrontation und der Koexistenz nehmen die Beiträge des Bandes in den Blick.
Link zum Verlag
Bd. 40
Arnd Beise: Geschichte, Politik und das Volk im Drama des 16. bis 18. Jahrhunderts. Berlin/Boston: de Gruyter 2010 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 40).
Der Aufstand war in der Frühen Neuzeit eine gewöhnliche soziale Form im Leben der Unterschichten. Der Theorie nach war vom „unverständigen Pöbel“ kein eigenständiges politisches Handeln zu erwarten, obwohl man mit Freud die gesamte „westeuropäische Kultur“ als Produkt der „Angst vor dem Aufstand der Unterdrückten“ bezeichnen könnte. Die Dramatiker der Zeit aber hatten auf die ‚Gesten des Volksaufstands‘ zu reagieren, denn das Trauerspiel galt als „Schul der Könige“. So entstanden Stücke, die an der politischen wie poetischen Theorie vorbei das ‚Volk in der Revolte‘ in actu präsentierten. Wie dies geschah, führt Arnd Beise an herausragenden Beispielen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert vor.
Link zum Verlag
Bd. 39
Ernst Stöckmann: Anthropologische Ästhetik. Philosophie, Psychologie und ästhetische Theorie der Emotionen im Diskurs der Aufklärung. Berlin/Boston: de Gruyter 2009 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 39).
Die vorliegende Untersuchung thematisiert den systematischen Zusammenhang anthropologischer und ästhetischer Reflexion im 18. Jahrhundert und versteht sich als Beitrag zur Theoriegeschichte des ästhetischen Denkens im 18. Jahrhundert am Leitfaden des Emotionsbegriffs. Auf der Basis eines erweiterten Ästhetikbegriffs wird auf Texte der philosophischen Affekttheorie, Erfahrungspsychologie, Anthropologie und Kunsttheorie von Descartes über die deutsche Popularphilosophie zugegriffen und in exemplarischen Lektüren verfolgt, wie im Ästhetikdiskurs des späten 18. Jahrhunderts die Wende zum ästhetischen Subjekt, zum Gefühl interdisziplinär begründet wird.
Link zum Verlag
Bd. 38
Friedemann Stengel (Hrsg.): Kant und Swedenborg. Zugänge zu einem umstrittenen Verhältnis. Tübingen 2008.
In Kant als dem führenden Vertreter der philosophischen Aufklärung und dem Geisterseher Swedenborg stehen sich zwei auf den ersten Blick ganz gegensätzliche Repräsentanten des 18. Jahrhunderts gegenüber. Zugleich war Swedenborg einer der wenigen Autoren, denen Kant ein eigenes Werk, die Träume eines Geistersehers, widmete. Seither ist kontrovers über die Bedeutung Swedenborgs für Kants philosophische Biographie und Werksgeschichte diskutiert worden. Im vorliegenden Band stellen Philosophen, Religionswissenschaftler, Theologen und Literaturwissenschaftler aus sechs Ländern ihre Deutungen des umstrittenen Verhältnisses zwischen Kants kritischer Philosophie und Swedenborgs „visionärem Rationalismus“ vor.
Link zum Verlag
Bd. 37
Monika Neugebauer-Wölk (Hrsg.): Aufklärung und Esoterik. Rezeption – Integration – Konfrontation. Tübingen 2008.
Im Zeitalter der Aufklärung hält die Auseinandersetzung mit Traditionsbeständen aus Neuplatonismus und Hermetismus, Pythagoreismus, Magie, Alchemie und Kabbala an, die heute unter dem Begriff der frühneuzeitlichen Esoterik zusammengefasst werden. Das Spektrum der Aneignung reicht dabei von kritischer oder historisierender bis hin zu emphatisch zustimmender Rezeption und Integration. Doch kommt es auch zu polemischen Konfrontationen mit den neu entstehenden esoterischen Formationen im Diskurs der Epoche. Die Beiträge des Bandes erkunden diese spannungsreichen Konstellationen mit ihren Verlaufswegen im 18. Jahrhundert.
Link zum Verlag
Bd. 36
Annette Meyer: Von der Wahrheit zur Wahrscheinlichkeit. Die Wissenschaft vom Menschen in der Schottischen und Deutschen Aufklärung. Tübingen 2008.
Die Neudeutung des Kosmos in der Frühen Neuzeit blieb nicht folgenlos für das Selbstverständnis des Menschen. Spätestens seit Mitte des 18. Jahrhunderts sollte auch die Frage nach dem Ursprung und der Diversität der Menschen mit einer an der Naturphilosophie ausgerichteten Methode gelöst werden. Einen bedeutenden Beitrag zu diesem Unternehmen leistete die schottische Aufklärung mit der Wissenschaft vom Menschen. Der methodische Impuls der Schotten fand in der deutschen Spätaufklärung vielfältige Fortentwicklungen. Gerade in der Popularphilosophie zeitigte die Rezeption des schottischen Modells eine eigenständige und bislang wenig erforschte Tradition: die pragmatische Historie oder historische Anthropologie.
Link zum Verlag
Bd. 35
Jörn Garber: "Die Stammutter aller guten Schulen". Das Dessauer Philanthropinum und der deutsche Philanthropismus 1774-1793. Tübingen 2008.
Das 1774 in Dessau gegründete Philanthropinum ist die erste deutsche Reformschule, die wissenschaftliche Unterrichtsplanung, berufspraktische Erziehungsziele und bürgerliche Normierungen entwickelt.Die neue Integrationswissenschaft ‚Pädagogik’ orientiert sich an den Werten der modernen Bürgerlichkeit. Das Dessauer Philanthropinum wurde von Kant als „Revolution“ der überkommenen Schulstrukturen eingeschätzt, weil Wissen durch Anschauung, Erfahrung und Praxisbewältigung erworben werden sollte. Die theoretischen Grundlagen der philanthropischen Erziehungstheorie basieren auf einer Kombination von anthropologischen, medizinischen, psychologischen, sozialökonomischen und moralischen Wissensformen.
Link zum Verlag
Bd. 34
Yvonne Wübben: Gespenster und Gelehrte. Die ästhetische Lehrprosa G. F. Meiers (1718-1777). Tübingen 2007.
Die Arbeit untersucht einen Gespenstertraktat, der 1747 vom Halleschen Aufklärer und Ästhetiker G. F. Meier publiziert wurde. Sie erschließt Diskursfelder, die sich thematisch an den Zentraltext anlagern. Dabei geraten neuplatonische, wahrnehmungstheoretische, ästhetische und psychologisch-medizinische Schriften in den Blick. Darüber hinaus werden die topischen und medialen Entstehungsbedingungen des Textes sichtbar. Wie andere Kurzprosatexte, die um 1750 in Halle entstanden, hat auch Meiers Traktat die Funktion, fachwissenschaftliches Wissen zu bündeln und breiteren Gelehrtenkreisen zugänglich zu machen. Sein Traktat trägt damit zur Ausbildung von Rezeptionsmustern bei, auf die literarische Autoren wie J.W. v. Goethe, F. Schiller, K. Ph. Moritz zurückgreifen. Ferner zeigt die Arbeit, dass die Gründung der Ästhetik in Halle auf die Empirisierung des Wissens reagiert. Vertreter der ästhetischen Disziplin nehmen Gespensterberichte zum Anlass, um über den Erfahrungsbegriff zu reflektieren und sich auf dem Marktplatz des Wissens gegen die aufkommenden New Sciences zu bewähren.
Link zum Verlag
Bd. 33
Rainer Godel: Vorurteil – Anthropologie – Literatur. Der Vorurteilsdiskurs als Modus der Selbstaufklärung im 18. Jahrhundert. Tübingen 2007.
Die Studie zeigt, dass es eine Verkürzung des aufklärerischen Diskurses wäre, betrachtete man das Vorurteil nur als Objekt der Aufklärung, als einen der von ihr anvisierten Angriffspunkte. Der Vorurteilsdiskurs wird vielmehr zum entscheidenden Modus aufklärerischer Selbstbefragung. Im literarischen und popularphilosophischen Nachdenken über das Vorurteil erschüttern anthropologiebasierte Argumente die rationale Gewissheit, mit der Vorurteile kritisiert und durch Wahrheit ersetzt werden sollten. Der deutschsprachige Vorurteilsdiskurs des 18. Jahrhunderts ermöglicht Aufklärung als Selbstaufklärung.
Link zum Verlag
Bd. 32
Markus Zenker: Therapie im literarischen Text. Johann Georg Zimmermanns Werk "Über die Einsamkeit" in seiner Zeit. Tübingen 2007.
Der Schweizer Johann Georg Zimmermann (1728–1795) gilt als Prototyp eines philosophischen Arzt-Schriftstellers. Die in der Forschungslandschaft "Literarische Anthropologie" angesiedelte Monographie untersucht einleitend Zimmermanns Bestimmung des Menschen im zeitgenössischen Kontext. Fünf daran anknüpfende Fragekreise analysieren sein Hauptwerk "über die Einsamkeit" (1784/85). Der Versuch einer Ortsbestimmung fragt nach der Literarität von Zimmermanns Gesamtwerk vor dem epochalen Hintergrund sowie nach medizin- und wissenschaftsgeschichtlichen Bezügen und nach seinem frommen Aufklärertum.
Link zum Verlag
Bd. 31
Christian Zwink: Imagination und Repräsentation. Die theoretische Formierung der Historiographie im späten siebzehnten und frühen achtzehnten Jahrhundert in Frankreich. Tübingen 2006.
Die französische Historiographie im Zeitraum von 1670 bis 1730 steht unter einer doppelten Maßgabe: zum einen, diskursives Wissen zu generieren, zum anderen bildgebende Verfahren, z. B. als zunächst desavouierte historische Einbildungskraft, sinnvoll zu integrieren. Noch vor der Verfestigung als eigene Disziplin wird das >historische Sehen< im Ausgleich zwischen reiner Gelehrsamkeit und philosophischer Spekulation in der Theorie gezähmt, zugleich damit aber auch für die Erkenntnis der Geschichte aufgewertet, sei es durch seinen Evidenzvorsprung, sei es durch seine konzeptuelle Phantasie.
Link zum Verlag
Bd. 30
Gunhild Berg: Erzählte Menschenkenntnis. Moralische Erzählungen und Verhaltensschriften der deutschsprachigen Spätaufklärung. Tübingen 2006.
Menschenkenntnis bedeutet gemäß den Moralgeboten der deutschen Aufklärung Menschenbeurteilung Die Studie weist nach, daß Moralische Erzählungen das hieraus resultierende Erkenntnisproblem der zeitgenössischen Moralphilosophie, Gesellschaftsethik und Anthropologie vorführen: die Unerkennbarkeit des anderen. Sie reflektieren den aufklärerisch selbst verschuldeten Widerspruch von Sitte, Sittlichkeit und Urteilen. Indem sie Moral- und Umgangslehre mit dem fiktionalen Blick in das Innere des anderen verbinden, kompensieren sie das Nicht-Wissen vom Menschen am Ende des 18. Jahrhunderts.
Link zum Verlag
Bd. 29
Andre Rudolph: Figuren der Ähnlichkeit. Johann Georg Hamanns Analogiedenken im Kontext des 18. Jahrhunderts. Tübingen 2006.
Entgegen der These Foucaults vom Ende der Ähnlichkeit im 17. Jahrhundert und entgegen der gängigen Auffassung, das Analogiedenken habe in der Aufklärung keine signifikante Bedeutung mehr gehabt, beobachtet die Studie zahlreiche philosophische, poetische und religiöse Analogieformationen der Epoche. Ein problemgeschichtlicher Überblick erschließt Analogiemodelle bis 1750. Der zweite Teil der Untersuchung widmet sich Formen und Figuren der Analogie im Werk des Königsberger Publizisten Johann Georg Hamann (1730–1788), im Gespräch mit der religiösen Apologetik seiner Zeit, mit Sokrates, Herder und Kant.
Link zum Verlag
Bd. 28
Manfred Beetz / Hans-Joachim Kertscher (Hrsg.): Anakreontische Aufklärung. Tübingen 2005.
Der auf ein Kolloquium im Gleimhaus Halberstadt zurückgehende Band vereinigt Beiträge, die sich dem Verhältnis von Rokokoliteratur, Anakreontik und Empfindsamkeit im Alten Reich widmen. Behandelt wird vornehmlich der Zeitraum von 1740 bis 1780, vier Jahrzehnte, die von interdiskursiven Überschneidungen kunsttheoretischer, anthropologischer und ästhetischer Natur gekennzeichnet waren. Die Beiträge gehen den Interferenzen bzw. Differenzen der kulturpsychologischen, mentalitätsgeschichtlichen und moralphilosophischen Diskurse nach und betten diese in den Gesamtprozeß 'Aufklärung' ein.
Link zum Verlag
Bd. 27
York-Gothart Mix (Hrsg.): Der Kalender als Fibel des Alltagswissens. Interkulturalität und populäre Aufklärung im 18. und 19. Jahrhundert. Tübingen 2005.
Volkskalender des 18. und 19. Jahrhunderts sind ein singuläres medienhistorisches Zeugnis der Alltagserfahrung von interkultureller Dimension. Die Beiträge analysieren ihre Genese, die Text-Bild-Relation, genretypische Charakteristika, genderspezifische Fragen, die transkulturelle Relevanz dieses Lesestoffs sowie die Rolle im Prozeß einer Popularisierung der Aufklärung in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und den USA. Der Band knüpft an zwei Forschungsprojekte der Stiftung Volkswagen und der DFG an, die der Herausgeber mit Hans-Jürgen Lüsebrink und Jean-Yves Mollier realisiert hat.
Link zum Verlag
Bd. 26
Jürgen Overhoff: Die Frühgeschichte des Philanthropismus (1715-1771). Konstitutionsbedingungen, Praxisfelder und Wirkung eines pädagogischen Reformprogramms im Zeitalter der Aufklärung. Tübingen 2004.
Das Erziehungsprogramm des Philanthropismus markiert den Beginn der modernen Bildungsreform. Unbekannt war bislang, daß die Anfänge dieser Erziehungstheorie im ab 1715 einsetzenden Diskurs der hamburgischen Frühaufklärung zu suchen sind und daß die philanthropische Pädagogik schon seit den 1750er Jahren im dänischen Gesamtstaat in der Schulpraxis erprobt wurde. Die Studie beschreibt diese Frühgeschichte des Philanthropismus im Detail und kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die von Johann Bernhard Basedow und Johann Andreas Cramer konzipierte Pädagogik im wesentlichen eine theologisch motivierte Erziehung zur religiösen Toleranz war.
Link zum Verlag
Bd. 25
Günter Dammann / Dirk Sangmeister (Hrsg.): Das Werk Johann Gottfried Schnabels und die Romane und Diskurse des frühen achtzehnten Jahrhunderts. Tübingen 2004.
Die hier vorgelegten, zum Teil erheblich erweiterten Beiträge zu einer Tagung über Johann Gottfried Schnabel, die Anfang 2002 in Halle stattfand, zielen auf eine Erweiterung des Feldes, in dem der Autor der Insel Felsenburg zu vermessen wäre. Das Werk wird neu gesehen mit Blick auf Leibniz und Thomasius, auf die hermetische Philosophie und die Gespenstertheologie, auf Kultur- und Anthropologiekonzepte. Zugleich kommt der Stellenwert von Schnabels Romanen wie auch seiner (einzigen) Festbeschreibung innerhalb der – umfassender nachgezeichneten – jeweiligen frühaufklärerischen Gattungsprofile genauer zur Erscheinung.
Link zum Verlag
Bd. 24
Jörn Garber / Heinz Thoma (Hrsg.): Zwischen Empirisierung und Konstruktionsleistung: Anthropologie im 18. Jahrhundert. Tübingen 2004.
Die bisherige Forschung hat den anthropologischen Paradigmawechsel der europäischen Spätaufklärung (ca. 1750 - 1800) vorwiegend als einheitlichen Prozeß gedeutet und die Gegenstandsfelder jeweils nur sektoral abgehandelt. Der vorliegende Band geht einen anderen Weg. Er insistiert auf dem Zusammenhang von Konstruktions- und Gegenstandslogik in der Anthropologie und begreift ihn als Ausdifferenzierung im Spannungsfeld von physischem und sittlichem Menschen. Die Einzelstudien behandeln folgende Themen bzw. Interpretationsverfahren: Das Verhältnis von Soma und Pneuma; die Selbsterzeugung des Menschen im naturhistorischen Prozeß; Anthropologie und Zivilisationsgenese; Empirismus als anthropologische Erkenntnisform; Anthropologie und Utopie; fiktive Anthropologie als Erkenntnisverfahren; Philosophie, Wissenschaft und Mythos.
Link zum Verlag
Bd. 23
Tanja van Hoorn: Dem Leibe abgelesen. Georg Forster im Kontext der physischen Anthropologie des 18. Jahrhunderts. Tübingen 2004.
Georg Forster (1754-1794) hat in seiner berühmten "Reise um die Welt" sowie in den Aufsätzen "Noch etwas über die Menschenraßen" und "Leitfaden zu einer künftigen Geschichte der Menschheit" kenntnisreich und engagiert zu den zentralen Streitfragen der physischen Anthropologie Stellung bezogen. Die vorliegende Untersuchung macht in einer quellenbezogenen Rekonstruktion erstmalig den wissenschaftsgeschichtlichen Anspielungs- und Diskussionshorizont dieser Texte sichtbar und zeigt, wie Forster sich im Spannungsfeld der einschlägigen Debatten und Kontroversen positioniert: Die geplante "neue Anthropologie" hat er nie geschrieben – in ihren Grundlinien wird sie hier dennoch erkennbar.
Link zum Verlag
Bd. 22
Jean-François Goubet u. Oliver-Pierre Rudolph (Hrsg.): Die Psychologie Christian Wolffs. Systematische und historische Untersuchungen. Tübingen 2004.
Die Psychologie nimmt im Werk Christian Wolffs (1679-1754) eine zentrale Stellung ein. Sie begründet die Logik und die praktische Philosophie mit Naturrecht, Ethik, Politik und Ökonomik. Der vorliegende Band geht den vielfältigen Problemen nach, die sich mit Wolffs Konzeption einer rationalen und einer empirischen Psychologie einerseits, ihrer Grundlegungsfunktion innerhalb des Wolffschen Systems der Philosophie andererseits ergeben. Darüber hinaus stellt er die Psychologie Wolffs in den philosophie- und wissenschaftsgeschichtlichen Kontext von der Scholastik bis zur kritischen Philosophie Immanuel Kants.
Link zum Verlag
Bd. 21
Holger Zaunstöck u. Markus Meumann (Hrsg.): Sozietäten, Netzwerke, Kommunikation. Neue Forschungen zur Vergesellschaftung im Jahrhundert der Aufklärung. Tübingen 2003.
Die Sozietäten rücken neuerdings wieder verstärkt in den Blick bei der Erforschung des 18. Jahrhunderts. Standen früher vor allem die sogenannten 'Aufklärungsgesellschaften' im Mittelpunkt, zieht nun ein breiteres Spektrum von Gesellschaftsbildungen die Aufmerksamkeit von Geistes- und Kulturwissenschaftlern verschiedenster Disziplinen auf sich. Verbindendes Element ist das gemeinsame Interesse an der Ausbildung von Soziabilität, Netzwerken und Kommunikationsstrukturen. Der im Titel formulierte Dreischritt hat somit programmatischen Charakter: Studien zu einzelnen Sozietäten und Mitgliedern sowie Analysen personeller und institutioneller Netzwerke bilden die Grundlage für ein sich abzeichnendes Bild einer Kommunikationsgeschichte der Vergesellschaftung im 18. Jahrhundert.
Link zum Verlag
Bd. 20
Manfred Beetz u. Herbert Jaumann (Hrsg.): Thomasius im literarischen Feld. Neue Beiträge zur Erforschung seines Werkes im historischen Kontext. Tübingen 2003.
Der auf eine Tagung in Halle zurückgehende Band versucht, das Verhältnis des Christian Thomasius (1655-1733) zu Literatur und Gelehrtenkultur mit Hilfe von Pierre Bourdieus Theorie des "literarischen" bzw. des "intellektuellen Feldes" zu untersuchen. Im Fragehorizont des Feldbegriffs als einer mehr oder weniger expliziten, blicklenkenden Heuristik wird nach dem literarisch-kulturellen Wissen, den ästhetischen und poetologischen Konzepten und Leitbildern und der "Ökonomie der Praxis" des Thomasius als Gelehrter, Satiriker, Kritiker gefragt sowie nach den Impulsen, die er seinerseits der Umgebung mitteilt. Schließlich geht es um die Feldstrukturen selbst, in denen er und seine Bezugsautoren agieren, lokal in Leipzig und Halle sowie überregional über die Printmedien vermittelt.
Link zum Verlag
Bd. 19
Carsten Zelle (Hrsg.): Vernünftige Ärzte. Hallesche Psychomediziner und die Anfänge der Anthropologie in der deutschsprachigen Frühaufklärung. Tübingen 2001.
Der Band konturiert die Bedeutung der "vernünftigen Ärzte" in Halle um Stahl, Krüger, Unzer, E. A. Nicolai, Bolten u.a. für die anthropologische Wende um 1750. Gezielt wird damit auf die Anthropologie vor der Anthropologie (im Sinne Platners und der spätaufklärerischen "philosophischen Ärzte"). Im Zentrum stehen 1.) die Entstehungsbedingungen von Anthropologie und Ästhetik (Baumgarten, Meier u.a.) im Kontext von Stahlianismus, Pietismus, Thomasianismus und Wolffianismus, 2.) die Vordatierung der Ursprünge der Anthropologie im deutschsprachigen Raum von der Spät- in die Frühaufklärung, 3.) die Gleichursprünglichkeit von Anthropologie und Ästhetik aufgrund eines vergleichbaren, antikartesianischen Impulses, d.h. die Supplementierung der herkömmlichen Logik um eine 'Logik der sensitiven Erkenntnis' (d.i. Ästhetik) und ein ganzheitliches, Leib und Seele umfassendes Menschenbild (d.i. Anthropologie). Die Beiträge leisten einen Beitrag zur Erforschung jener disziplinären Bereiche der Moderne, die vom Kartesianischen Wissenschaftsdispositiv verdrängt worden und in der Wissenschaftsgeschichtsschreibung unthematisch geblieben sind. Der antikartesianische Impuls von Ästhetik und Anthropologie um 1750 macht die "vernünftigen Ärzte" anschlußfähig an heutige Überlegungen zu Psychosomatik und ganzheitlichen Therapieansätzen und bildet die Brücke zu einer 'Logik des Individuellen'.
Link zum Verlag
Bd. 18
Erhard Hirsch: Die Dessau-Wörlitzer Reformbewegung im Zeitalter der Aufklärung. Personen – Strukturen – Wirkungen. Tübingen 2003.
Licht in die Köpfe zu bringen war das erklärte Ziel der Aufklärer: Wie nirgends sonst wurde die Aufklärung im Fürstentum Anhalt-Dessau demonstrativ praktiziert. Seit der Berufung des verketzerten Basedow, der 1774 das Philanthropin gründete, war Dessau-Wörlitz in aller Munde. Hirsch mustert kritisch alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens an Hand der oft enthusiastischen Lobreden der Besucher und der Publizistik über dieses Zentrum der Aufklärer, wo man die Vorurteile abbaute, die Emanzipation der Juden voranbrachte und in einem Gartenreich die pädagogische Provinz und den "Friedensstaat" der Aufklärung verwirklichte.
Link zum Verlag
Bd. 17
Christophe Losfeld: Philanthropisme, Libéralisme et Révolution. Le ›Braunschweigisches Journal‹ et le ›Schleswigsches Journal‹ (1788-1793). Tübingen 2002.
Die pluridisziplinäre Analyse dieser beiden Zeitschriften stellt einen originären Beitrag zur Rezeption der Französischen Revolution in Deutschland dar. Die Arbeit basiert auf einem kontinuierlichen Vergleich der historischen Bedingungen beider Länder zu dieser Zeit und, daraus resultierend, auf einer Darstellung des komplexen Spiels zwischen Erfahrungsraum und Erwartungshorizont. Dabei zeigt sich, wie untrennbar die Wahrnehmung der revolutionären Geschehnisse mit der repressiven Politik Preußens unter Friedrich Wilhelm II. verbunden ist: Die durch diese Politik bedingte Neuformulierung der ursprünglich dominierenden philanthropischen Thesen im Journal zugunsten einer protoliberalen Position erklärt die anfängliche Begeisterung für die Revolution und zugleich deren Grenzen. Denn ihre Vertreter werden innerhalb der deutschen Gelehrtenrepublik angefeindet und von den Regierungen im Reich zunehmend unterdrückt. Führen die Autoren der Journale zuerst standhaft ihren Kampf für die Freiheit, so gelangen sie dennoch wegen der Radikalisierung der Situation in Frankreich zu einer kritischen Bewertung der Revolution. Während die Autoren des Braunschweigischen Journals, getragen von der Hoffnung auf die Einleitung einer vergleichbaren Politik der Reformen in Deutschland, ihr Augenmerk nach Frankreich richten, wenden sich die Verfasser des Schleswigschen Journals von Frankreich ab.
Link zum Verlag
Bd. 16
Martin Mulsow: Die drei Ringe. Toleranz, Gelehrsamkeit und clandestine Kommunikation bei Mathurin Veyssière La Croze (1661-1739). Tübingen 2001.
Wie sieht die Subgeschichte der Frühaufklärung aus? Mathurin Veyssière La Croze war Benediktiner in Paris und dann Bibliothekar des preußischen Königs in Berlin. Das Nachspüren seiner Fluchtwege, Netzwerke und intellektuellen Interessen ermöglicht einen Einblick in die Verbindung von gelehrten Debatten mit persönlichen Beziehungen zu Juden, Atheisten oder Sozinianern. Den Anlaß bietet eine französische Versbearbeitung der Ringparabel, in der die Toleranzfrage im Kontext der Situation der exilierten Hugenotten nach 1685 gestellt wird. Die Suche nach dem Autor endet schließlich im Holland der Buchfabrikanten und Refugiés um 1720.
Link zum Verlag
Bd. 15
Axel Rüdiger: Staatslehre und Staatsbildung. Die Staatswissenschaft an der Universität Halle im 18. Jahrhundert. Tübingen 2005.
Die akademische Etablierung der neuzeitlichen Staats- und Verwaltungswissenschaft ist während des 18. Jahrhunderts in besonderer Weise mit der Geschichte der preußischen Landesuniversität Halle verknüpft. In exemplarischer Manier wird die Darstellung des Staates hier selbst zum integralen Bestandteil frühmoderner Staatsbildung. Die Arbeit verbindet die ideengeschichtliche Untersuchung des frühneuzeitlichen Strukturwandels Politischer Wissenschaft mit der milieusoziologischen Analyse der Universität. Die Transformation der methodischen Einstellungen und der hieraus resultierenden politischen Ordnungsmodelle werden im Schnittpunkt von wissenschaftlichem und bürokratischem Feld transparent gemacht.
Link zum Verlag
Bd. 14
Jörn Garber und Ulrich Kronauer (Hrsg.): Recht und Sprache in der deutschen Aufklärung. Tübingen 2001.
Das Konzept der Begriffsgeschichte hat in den verschiedensten Fächern nach 1945 Innovationsprozesse ausgelöst. Die Themenstellung "Recht und Sprache" verweist auf eine sehr viel ältere Tradition. Bezogen auf das Zeitalter der Aufklärung wird in diesem Band die Leistungsfähigkeit beider Zugänge an unterschiedlichsten Fragestellungen erprobt: Probleme der Terminologie bei Wolff, Mendelssohn und Kant; die Herausbildung von Fachsprachen bei Leibniz; Rechtssprache und Lexikographie; die (sprachliche) Behandlung von Minderheiten; juristische Schreibart und Hermeneutik im 18. Jahrhundert; aufklärerische Tendenzen in der Gesetzessprache; schließlich literarische Transpositionen von Rechtsterminologien. Der Band erstrebt eine Synthese von methodologischer Innovation und konkreter Quellenanalyse.
Link zum Verlag
Bd. 13
Johanna Geyer-Kordesch: Georg Ernst Stahl. Pietismus, Medizin und Aufklärung in Preußen im 18. Jahrhundert. Tübingen 2000.
Georg Ernst Stahl (1659-1734) kämpfte dagegen, das Lebendige und Intelligente in der Natur auf einen wissenschaftlichen Materialismus zu reduzieren. Seine 'Theoria Medica Vera' (1708) zeigte die Einheit von Körper und Seele. Damit war er ein wichtiger Vertreter eines integrierten Verständnisses innerer und äußerer Wahrnehmungen, von Gefühl, Verstand, Einbildungskraft und Sinneseindruck. Das Buch beschäftigt sich mit dem Leben Stahls und seinem Wirken an der Universität Halle und am Preußischen Hof in Berlin. Besondere Aufmerksamkeit gewinnt sein enger Kontakt mit dem Pietismus August Hermann Franckes.
Link zum Verlag
Bd. 12
Jörn Garber (Hrsg.): Wahrnehmung – Konstruktion – Text. Bilder des Wirklichen im Werk Georg Forsters. Tübingen 2000.
Im Gegensatz zu dem Weltreisenden und Revolutionär Georg Forster ist der Autor Forster, der Theoretiker der Wahrnehmung und der Beschreibung wenig bekannt. Der Band vereinigt Studien zu unterschiedlichen Werkgruppen Forsters, die befragt werden nach der Aneignung des "Wirklichen" durch "Erfahrung", "Verstand", "Idee", "Bild" und "Totaleindruck" im Spannungsfeld von Perzeption und Möglichkeitskonstruktion. Konkrete Textanalyse, Bestimmung der Wirkungsabsicht des Autors bzw. der Arbeitsverfahren des "gesellschaftlichen Schriftstellers" eröffnen ein neues Forster-Bild.
Link zum Verlag
Bd. 11
Wolfgang Albrecht u. Hans-Joachim Kertscher (Hrsg.): Wanderzwang – Wanderlust. Formen der Raum- und Sozialerfahrung zwischen Aufklärung und Frühindustrialisierung. Tübingen 1999.
Der Band versammelt Beiträge, die im Rahmen einer Tagung am Interdisziplinären Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung gehalten wurden. Diese stellte sich die Aufgabe, einem Forschungsdesiderat nachzugehen: dem Stellenwert der Fußreise innerhalb der deutschsprachigen Reiseliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts. Behandelt werden autobiographische und dichterische Texte, die in exemplarischer Weise Auskunft geben über einen Sachverhalt: der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einsetzenden sozialen Aufwertung der Reise zu Fuß (und deren Reflexion), die einhergeht mit einer Raumerfahrung, die aus der Sicht des Kutschenreisenden so nicht möglich war. – Ergänzt wird der Band durch eine Quellenbibliographie zu den Fußreisen in dem behandelten Zeitraum.
Link zum Verlag
Bd. 10
Richard Saage u. Eva-Maria Seng (Hrsg.): Von der Geometrie zur Naturalisierung. Utopisches Denken im 18. Jahrhundert zwischen literarischer Fiktion und frühneuzeitlicher Gartenkunst. Tübingen 1999.
Mitte des 18. Jahrhunderts fand im Diskurs der Aufklärung eine bedeutsame Umorientierung statt. Der einseitige Rationalismus wurde abgelöst durch eine Konzeption des "Ganzen Menschen", die nun auch seine Sinnlichkeit als Erfahrungsraum der Vernunft zum Gegenstand hatte. Vor diesem Hintergrund untersuchen 13 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Fachdisziplinen in den Beiträgen dieses Bandes, wie sich die anthropologische Wende auf die utopische Literatur sowie die von ihr beeinflußte Landschaftsgestaltung und Architektur ausgewirkt hat. Der vorliegende Versuch besticht gerade dadurch, daß erstmals der gesamte Paradigmenwechsel in interdisziplinärer Zusammenschau vorgestellt wird.
Verlag zum Link
Bd. 9
Holger Zaunstöck: Sozietätslandschaft und Mitgliederstrukturen. Die mitteldeutschen Aufklärungsgesellschaften im 18. Jahrhundert. Tübingen 1999.
Gesellschaftliches Substrat der Aufklärung waren die Aufklärungsgesellschaften im Ancien Régime. In Gelehrten und Patriotischen Sozietäten, Freimaurerlogen, Lesegesellschaften und Geheimbünden trafen sich Adelige und Bürgerliche, Gelehrte und Kaufleute, Professoren und Studenten zu gemeinsamer Tätigkeit. Über die Strukturen dieser gibt es jedoch bis heute keine prosopographisch fundierten Studien zu einer ausgedehnten Sozietätslandschaft. In seiner vorliegenden Arbeit stellt sich der Autor deshalb anhand der Aufklärungsgesellschaften Mitteldeutschlands die Aufgabe, diese Strukturen systematisch zu analysieren. Wieviele solcher Sozietäten hat es wo und wann im 18. Jahrhundert gegeben? Wer war in ihnen Mitglied? Existierten die Gesellschaften isoliert voneinander oder waren sie über Doppelmitgliedschaften und Sozietätskarrieren verbunden – läßt sich ein Netzwerk der Aufklärer nachweisen?
Link zum Verlag
Bd. 8
Giorgio Cusatelli, Maria Lieber, Heinz Thoma u. Edoardo Tortarolo (Hg.): Gelehrsamkeit in Deutschland und Italien im 18. Jahrhundert. Tübingen 1999.
Der Band versammelt die Akten einer Tagung der deutschen und italienischen Gesellschaften für die Erforschung des 18. Jahrhunderts. Der Bogen spannt sich von der noch lateinisch geprägten Gelehrsamkeit aus dem frühen 18. Jahrhundert bis zu naturwissenschaftlichen und kulturtheoretischen Problemstellungen der späten Aufklärung. Die erste Abteilung "Kontakte" verhandelt komparative Aspekte wie Brief-, Orts- und Kontextwechsel, nationale Standpunkte bei der literarischen Wertung, kontrastive Gelehrtenideale, Übersetzungen. Die zweite Abteilung "Institutionen" präsentiert Untersuchungen zur Gelehrsamkeit in Oper und Theater, zu ihrer Institutionalisierung in Akademien sowie ihrer Verbreitung durch Drucker bzw. Verlage.
Link zum Verlag
Bd. 7
Martin Mulsow u. Helmut Zedelmaier (Hrsg.): Skepsis, Providenz, Polyhistorie. Jacob Friedrich Reimmann (1668-1743). Tübingen 1998.
Jakob Friedrich Reimmann steht zwischen Barock und Aufklärung. Er ist einer der großen Vertreter der Literaturgeschichte (Historia litteratia) im frühen 18. Jahrhundert, jener vergessenen Disziplin, die Bildungs-, Wissenschafts- und Buchgeschichte sein wollte und von Reimmann in systematischer Weise für viele Disziplinen und Kulturen durchgeführt worden ist. Sein Werk kann als exemplarisch für die Spannungen gelten, die sich zwischen einem traditionellen Vertrauen auf eine providentiell geordnete Geschichte und der neuen, skeptisch-hypothetischen Wissenschaftskultur ergaben.
Link zum Verlag
Bd. 6
Dirk Sangmeister: August Lafontaine oder Die Vergänglichkeit des Erfolges. Leben und Werk eines Bestsellerautors der Spätaufklärung. Tübingen 1998.
Die leser- und sozialgeschichtlich fundamentierte Monographie des zu Lebzeiten weithin berühmten, heute gründlich vergessenen August Lafontaine (1758-1831) rekonstruiert und analysiert Leben und Werk dieses enorm produktiven Unterhaltungsautors der Spätaufklärung, der mit seinen seriell fabrizierten Familien- und Liebesromanen im Zuge der Leserevolution und parallel zur Blütezeit von Klassik und Romantik zum ersten freien Schriftsteller und meistgelesenen Erzähler seiner Zeit in Deutschland avancierte.
Link zur Bibliothek
Bd. 5
Florian Maurice: Freimaurerei um 1800. Ignaz Aurelius Feßler und die Reform der Großloge Royal York in Berlin. Tübingen 1997.
Gestützt auf wissenschaftlich erstmals ausgewertete archivalische Quellen, unternimmt es diese kulturgeschichtliche Studie, die Freimaurerei anhand eines zentralen Ereignisses im Zusammenhang ihrer Zeit darzustellen. Ignaz Aurelius Feßler (1756-1839) reformierte um 1800 die Rituale und Verfassung der Berliner Großloge Royal York und nahm dabei in besonderem Maße philosophische, theologische und staatsrechtliche Ideen jener Zeit auf. Die Darstellung analysiert diese Vorgänge in ihren Verflechtungen und Zusammenhängen und widmet sich dabei besonders dem Innenleben der Freimaurerei, dem Bereich der Rituale, der Feste und Geselligkeit.
Link zum Verlag
Bd. 4
Monika Neugebauer-Wölk u. Richard Saage (Hrsg.): Die Politisierung des Utopischen im 18. Jahrhundert. Tübingen 1996.
Die mit Thomas Morus einsetzende klassische Utopietradition hat den Geltungsanspruch eines regulativen Prinzips bzw. eines Ideals vertreten. Das änderte sich im 18. Jahrhundert grundlegend. Wie die Aufklärung das Problem praktischer Wirklichkeitsveränderung in den Utopie-Diskurs einbrachte und dabei das 19. Jahrhundert antizipierende Formen der Legitimierung gesellschaftlicher Praxis hervorbrachte, ist das systematische Erkenntnisinteresse der in diesem Band gesammelten Beiträge. Sie sind aus dem Symposion zum Thema "Die Politisierung des Utopischen im 18. Jahrhundert" hervorgegangen, das im Frühjahr 1995 am Interdisziplinären Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung in Halle stattgefunden hat.
Link zum Verlag
Bd. 3
Hans-Joachim Kertscher (Hrsg.): G. A. Bürger und J. W. L. Gleim. Tübingen 1996.
Publiziert werden hier Vorträge, die während einer Tagung zum 200. Todestag Bürgers und zum 275. Geburtstag Gleims in Halberstadt gehalten wurden. Themen sind u. a. die Freundschaftsbeziehung zwischen Gleim und Bürger, die Dichtungs- und Freundschaftskonzepte des späten Gleim und sein Briefwechsel. Neue Zugänge werden eröffnet zu Bürgers Biographie, seinem "Münchhausen"-Buch und zu seiner Lehrtätigkeit an der Göttinger Universität. Ein Anhang bietet bislang nicht publiziertes Quellenmaterial zur sozialen Herkunft Bürgers.
Link zum Verlag
Bd. 2
Gottfried Hornig: Johann Salomo Semler. Studien zu Leben und Werk des Hallenser Aufklärungstheologen. Tübingen 1996.
In Leben und Werk Johann Salomo Semlers (1725-1791) spiegeln sich die Probleme der protestantischen Aufklärungstheologie des 18. Jahrhunderts und die Anfänge einer historisch-kritischen Theologie. Nachdem zuerst eine Biographie gegeben wurde, konzentriert sich die folgende Darstellung auf das Bibelverständnis und die Hermeneutik, die Christologie und Soteriologie sowie den Perfektibilitätsgedanken. Die Gründe für die einflußreiche Unterscheidung von christlicher Religion und wissenschaftlicher Theologie werden analysiert.
Link zum Verlag
Bd. 1
Theodor Verweyen (Hrsg.): Dichtungstheorien der deutschen Frühaufklärung. Tübingen 1995.
Der Band versammelt die Ergebnisse eines wissenschaftlichen Kolloquiums am Interdisziplinären Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (28.-30.10.1993). In europäischer Perspektive steht im Vordergrund die Batteux-Rezeption in der Halleschen Ästhetik. Im Bereich der Prosa geht es um die dichtungstheoretische Selbstverständigung für utopische Genres. Das Gros der Beiträge beschäftigt sich mit Problemstellungen der sich in Halle konstituierenden Ästhetik (A. G. Baumgarten, G. F. Meier), deren Relevanz für den poetologischen Diskurs der Frühaufklärung und ihre Wirksamkeit in der Dichtungspraxis vornehmlich der beiden Halleschen Dichterschulen (Pietismus, Anakreontik).
Link zum Verlag

