Die Aufklärung im Bezugsfeld neuzeitlicher Esoterik - DFG-Forschergruppe (2004–2012)
Die Anfang 2004 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bewilligte und 2007 für weitere drei Jahre verlängerte Forschergruppe „Die Aufklärung im Bezugsfeld neuzeitlicher Esoterik“ hat zum 30. April 2010 das Ende des maximalen Förderzeitraums erreicht. Die Laufzeit mehrerer Einzelprojekte hat sich aus verschiedenen Gründen über diesen Zeitpunkt hinaus erstreckt.
Inzwischen sind zum Ende des Jahres 2012 auch die verbliebenen Projekte abgeschlossen worden, und die Ergebnisse der einzelnen Projekte sowie der gemeinsamen Arbeit am Rahmenthema wurden der Deutschen Forschungsgemeinschaft in einem Abschlussbericht vorgelegt.
Die Forschergruppe stellt Ihnen diese Ergebnisse hier in einer überarbeiteten Fassung als PDF zum download zur Verfügung.
Festcolloquium zu Ehren von Monika Neugebauer-Wölk
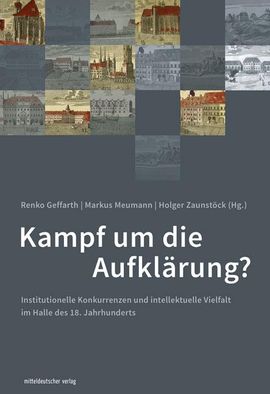
Berichtsbände

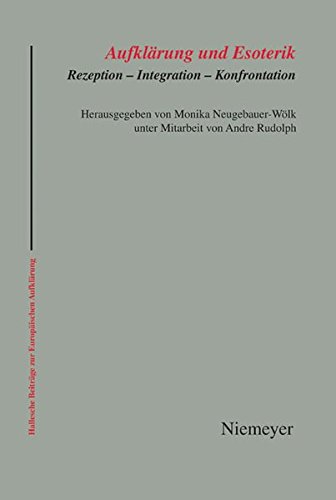
Monographien aus den Einzelprojekten
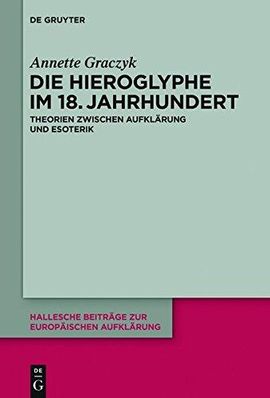
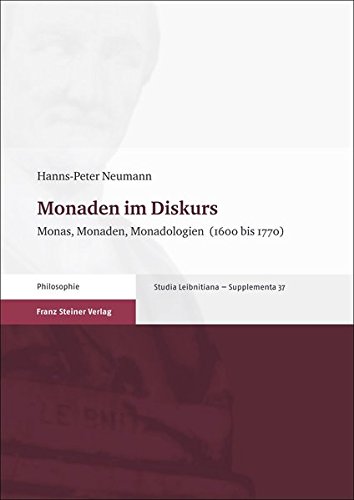
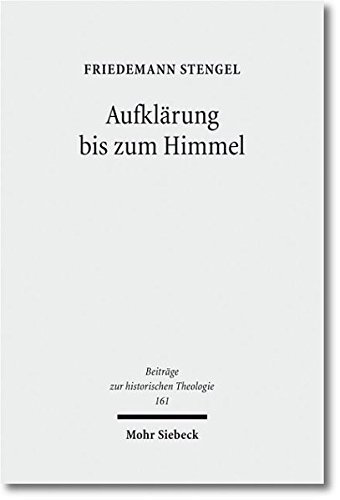
Sammelbände

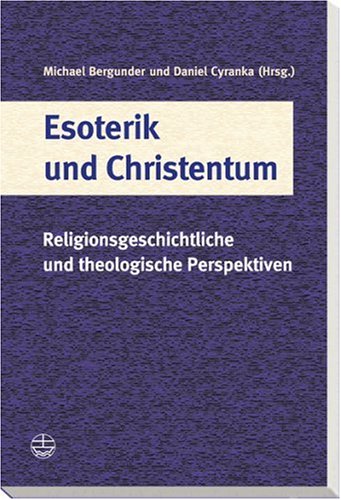
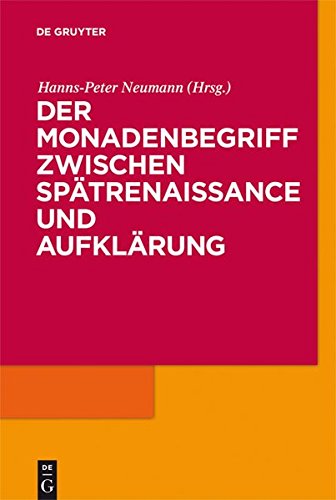
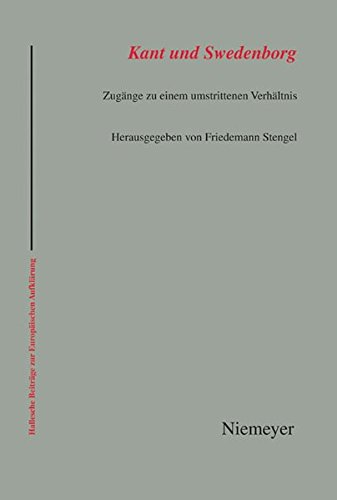
Markus Meumann (Hg.): Ordnungen des Wissens – Ordnungen des Streitens. Gelehrte Debatten des 17. und 18. Jahrhunderts in diskursgeschichtlicher Perspektive (Hallische Beiträge zur Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 7). Berlin 2014.
Zum Inhalt
Die Erforschung des gelehrten Wissens der Frühen Neuzeit wird aktuell disziplinübergreifend überwiegend als Wissensgeschichte konzeptualisiert. Diese betont jenseits fachspezifischer Zugänge und Methoden grundsätzlich die "Gemachtheit" des Wissens und rückt somit die Bedingungen der Wissensproduktion in den Vordergrund. Dennoch werden in der konkreten Analyse "Inhalte" und ihre sozialen, kommunikativen und medialen Entstehungskontexte in der Regel fast immer getrennt voneinander behandelt, wobei die jeweilige Schwerpunktsetzung nach wie vor meist disziplinären Fragestellungen und Gewohnheiten folgt. Die Autoren des vorliegenden Bandes versuchen dieses Problem zu überwinden, indem sie, ausgehend von den theoretischen und methodischen Anregungen Michel Foucaults, die agonale Disposition der Wissensordnungen im 17. und 18. Jahrhundert herausarbeiten. Gelehrte Streitkulturen werden dabei nicht allein als soziale Umgangsform oder rhetorisches Element begriffen, sondern als Grundbedingung frühneuzeitlicher Wissensproduktion, die Aneignungs- und Transformationsprozesse von Wissen in spezifischer Weise figurierte und deutliche Positionierungen herausforderte. Theoretische und methodische Perspektiven ebenso wie die Bedingungen gelehrten Streitens werden dabei zunächst jeweils in mehreren Beiträgen näher beleuchtet und schließlich in vier Fallstudien am Beispiel unterschiedlicher Debatten aus der Zeit zwischen 1684 und 1774 in produktiver Weise zusammengeführt.
Monika Neugebauer-Wölk (Hg.): Religionsgeschichte der Neuzeit. Profile und Perspektiven (zeitenblicke Online journal für die Geschichtswissenschaften 5 [2006], Nr. 1).

